
Smartphones und Buschhütten
Papua-Neuguinea ‐ Die Häuser sind nach wie vor aus Buschmaterial, aber fast jeder hat ein Smartphone. Die Moderne hat in Papua Neuguinea im Schnelldurchlauf Einzug gehalten. Das überfordert die Bevölkerung zum Teil sehr, erklärt die Schweizer Ordensfrau Lorena Jenal.
Aktualisiert: 19.12.2023
Lesedauer:
Die Häuser sind nach wie vor aus Buschmaterial, aber fast jeder hat ein Smartphone. Die Moderne hat in Papua-Neuguinea im Schnelldurchlauf Einzug gehalten. Das überfordert die Bevölkerung zum Teil sehr, erklärt die Schweizer Ordensfrau Lorena Jenal. Die Ordensfrau von der Gemeinschaft der Baldegger Schwestern lebt seit fast vierzig Jahren in Papua-Neuguinea. Dort setzt sich die Missio-Partnerin besonders für Frauen und ihre Rechte ein.
Frage: Schwester Lorena, was ist Ihre Hauptaufgabe in Papua-Neuguinea?
Jenal: Hauptsächlich arbeiten wir in unseren Gemeinden im südlichen Hochland mit Familien. Es geht um Eheprobleme, aber vor allem um Solidarität für Frauen und Kinder. Dabei ist es uns besonders wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Frauen, die beispielsweise unter Gewalt leiden, müssen lernen, sich selbst zu helfen und ihre Kinder zu schützen.
Denn ein großes Problem ist der Umgang mit Gewalt bei uns. Seit ich vor 38 Jahren nach Papua-Neuguinea gegangen bin, habe ich fünf Sippenkriege miterlebt. Der Kreis der Gewalt ist nicht leicht zu durchbrechen, vor allem, weil die Waffen immer ausgefeilter werden und sehr viel Schaden anrichten.
Der erste Krieg, den ich miterlebt habe, wurde noch mit Pfeil und Bogen gefochten. Der letzte allerdings brachte importierte Feuerwaffen zum Einsatz, wahrscheinlich im Austausch gegen Marihuana. Das ist ein gängiges Bezahlungsmittel in solchen Fällen. Die hohe Waffendichte verstärkt die ohnehin vorhandene Gewaltproblematik enorm.
Frage: Besonders am Herzen liegen Ihnen Frauen und Kinder. Mit welchen Problemen ist diese Gruppe konfrontiert?
Jenal: Frauen haben nach wie vor wenige Rechte, und Männer bedienen sich ihrer Kraft, um diesen Zustand so zu erhalten. Frauen und Kinder sind mit vielen Arten von Gewalt konfrontiert. Da ist die Gewalt durch die Sippenkriege, familiäre Gewalt und auch verbale Gewalt. Sie können nicht versuchen, diesen Kreis der Gewalt selbst zu durchbrechen, da sie keine Rechte haben.
Seit 2012 fällt uns eine neue Problematik auf: es ist ein Phänomen, was nicht kulturell verankert ist in Papua sondern recht neu ist – der Glaube an Hexen und die Verfolgung und Folterung von Frauen und Männern, die als Hexe bezeichnet werden. In den letzten 14 Monaten hatten wir von unserer Missionsstation mit 18 Opfern zu tun: davon 13 Frauen und fünf Männer.
Ich kann mir dieses neue Phänomen nur so erklären, dass der digitale Wandel und die Globalisierung so schnell in Papua Einzug gehalten haben, dass die Menschen nicht mitgekommen sind. Es ist quasi über Nacht passiert. Plötzlich ist eine riesige Welt im Internet verfügbar, mit Gewalt und Pornografie, das sehen die Menschen und sind überfordert. Es ist ja so, dass jeder ein Smartphone besitzt, auch wenn sie gar keinen Strom im Haus haben. Es kommt nicht selten vor, dass die Kinder die Handys mit in die Schule nehmen, um sie dort zu laden, oder sie werden zu uns in die Missionsstation geschickt, dass sie ihre Geräte dort wieder aufladen sollen.
„Der erste Krieg, den ich miterlebt habe, wurde noch mit Pfeil und Bogen gefochten.“

Frage: Wie beschreiben Sie die traditionelle Kultur, der Sie als junge Ordensschwester bei Ihrer Ankunft in Papua-Neuguinea begegnet sind?
Jenal: Ich bin vor 38 Jahren nach Papua gekommen. Ich hatte das Gefühl, Menschen aus der Steinzeit zu begegnen. Die Männer trugen Lendenschurz, die Frauen Grasröcke. Jeder hatte Pfeil und Bogen, das Leben war sehr einfach und traditionell. Die Menschen sorgten für ihren Lebensunterhalt.
Frage: Wie sind Sie dieser Kultur als Ordensschwester begegnet?
Jenal: Als Pädagogin und Psychologin habe ich mir gesagt: „Ich weiß nicht, was meine Aufgabe in Papua sein wird. Ich will es von den Menschen wissen.“ Als Missionarin ist natürlich eine meiner Aufgaben die Glaubensübermittlung. Aber davor kommt für mich die Vertrauensübermittlung. Denn jeder soll sein eigenes Leben entfalten dürfen und den Sinn seines persönlichen Lebens entdecken. Ich selbst bin eine Brücke, um die Menschen dorthin zu führen, in ihre persönliche Freiheit. Ich sehe das auch als meine Freiheit an, den Menschen ganz individuell begegnen zu können. Wir sind offen für Gespräche mit allen, egal welcher Glaubensrichtung. Wir sind eine ökumenische Initiative, und arbeiten mit Menschen aus fünf verschiedenen Glaubensrichtungen zusammen.
Frage: Welche sind Ihre größten Herausforderungen in der Arbeit mit Familien, die von Armut, Ungerechtigkeit und Gewalt betroffen sind?
Jenal: Die größte Herausforderung ist die Hilflosigkeit. Das Unvermögen, die Situation nicht ändern zu können für die Familien. Wenn eine Frau zu Hause geschlagen wird, werde ich ja erst dann gerufen, wenn die Frau schon geschlagen worden ist.
Immer wieder komme ich an meine menschlichen Grenzen. Und das bedeutet Mutlosigkeit in Situationen, in denen ich eigentlich anderen Kraft spenden sollte. Ich kann aber nur Kraft geben, wenn ich selbst Kraft habe. Dann muss ich mir eine Auszeit nehmen, einen Spaziergang machen, die Tusche zur Hand nehmen, einen Besuch bei einer Familie mit Kleinkind machen…ich brauche dann ein bisschen Abstand. Außerdem werde ich mittlerweile älter und merke: Ich kann nicht immer Volldampf geben. Die Botschaft „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ heißt für mich auch: man muss selber für sich Sorge tragen.
Eine andere Herausforderung in Papua im Gegensatz zur Schweiz ist auch die Ordentlichkeit (lacht). In der Schweiz weiß man, wie alles läuft. In Papua muss man immer auf alles gefasst sein und flexibel bleiben. Das ist auch eine Herausforderung.
„Der digitale Wandel und die Globalisierung haben hier quasi über Nacht Einzug gehalten.“
Frage: Mit der Zeit hat die Moderne in Papua-Neuguinea Einzug gehalten. Wie hat sich der Alltag für die Bevölkerung verändert?
Jenal: Alles hat sich gewaltig verändert, das Leben, die Umgebung, die Gewohnheiten der Menschen. Auch die Rollen in den Familien haben sich geändert. Früher war der Vater der Brotgewinner, der Führer der Familie. Die Mutter hat vielleicht einen kleinen Garten bewirtschaftet, um die Familie mit Lebensmitteln zu versorgen. Heute spielen die Männer Karten in der Stadt, geben das Geld, was sie haben oft sofort aus. Auch die Frauen gehen eher in die Stadt um Besorgungen zu machen, ein Garten ist vielen zu viel Arbeit. Die Landwirtschaft verschwindet immer mehr.
Außerdem sind viele Familien Patchwork-Familien.
Es gab auch eine Werteverschiebung: viele Bedürfnisse der modernen digitalen Gesellschaft werden von den Menschen in Papua höher angesehen, als manche existentiellen Bedürfnisse. Das sieht man an den Häusern: Wohnhäuser sind nach wie vor meistens aus Buschmaterial, die einzigen Wellblechhäuser sind das Kinohaus, das Krankenhaus und der Supermarkt.
Frage: Wie geht es für Sie weiter? Bleiben Sie in Papua-Neuguinea?
Jenal: Ja, solange es irgendwie geht (lacht). Mir sind die Arbeit und die Menschen dort ans Herz gewachsen, es ist meine Lebensaufgabe geworden, den Menschen dort beizustehen. Ich möchte sichergehen, dass sich auch nach mir genügend Menschen für ein Leben ohne Gewalt einsetzen, dafür brauchen wir noch viele freiwillige Helfer. Mittlerweile haben wir ungefähr 50 freiwillige Mitarbeiter, aber es müssen noch mehr werden. Sonst befürchte ich, dass das Problem mit der Hexenverfolgung nur weiter zunimmt und wirklich eskaliert.
Die Fähigkeit der Menschen, ihre Gemeinschaft zu pflegen, darf nicht verloren gehen. Solange ich das Gefühl habe, die Gemeinschaft braucht mich, möchte ich da sein. Da gibt es einen schönen Ausspruch, den ich noch aus meinem Studium kenne: „Sitze. Höre. Und Bleibe.“ Das ist das allerwichtigste.
Frage: Wie nehmen Sie den Konflikt mit den von Australien internierten Flüchtlingen wahr?
Jenal: Vor vier Jahren war ich mal dort im Lager auf den Manus-Inseln, es war von Anfang an sehr problematisch. Die Menschen dort stammen aus dem Irak, Iran und Afghanistan. Aber die Menschen in Papua sind nicht gefragt worden, ob sie einverstanden sind, dass hier ein Flüchtlingslager aufgemacht wird. Ich höre aus der Bevölkerung, und ich vermute das auch, dass ein Deal der Regierungen dahinter steckt: unsere Regierung nimmt Geld von der australischen Regierung, und nimmt im Gegenzug Flüchtlinge aus Australien auf. Es ist Korruption. Eine unendliche Tragik, denn es gab auch Unruhen und bereits einen Toten.
Frage: Wie bewertet die Bevölkerung von Papua-Neuguinea die Internierung dieser Flüchtlinge?
Jenal: Beide, die Bevölkerung und die Flüchtlinge, haben große Angst. Die Flüchtlinge leben sozusagen in Isolation, es gibt keinerlei Verständigung. Die Probleme der Menschen in Papua sind auch existenziell, deshalb haben die Flüchtlinge hier keinerlei Perspektive auf ein besseres Leben. Das stiftet Unruhe, es gab schon Übergriffe auf Flüchtlinge, und das Lager wurde schon mehrfach überfallen und ausgeraubt. Ein Toter musste beklagt werden.
Das Interview führte Claudia Zeisel
© weltkirche.katholisch.de
19.12.2023: Schlagwörter hinzugefügt

Katholische Kirche hat sieben neue Heilige

Schwester Lorena rettet Frauen vor der Hexenverfolgung

Don Bosco Schwestern feiern 25 Jahre Präsenz in Papua Neuguinea

Verbreiteter Hexenwahn: Ordensfrau fordert verstärkten Kampf gegen Gewalt

Klimawandel und Frauenrechte – Dringender Appell der katholischen Kirche in Papua-Neuguinea
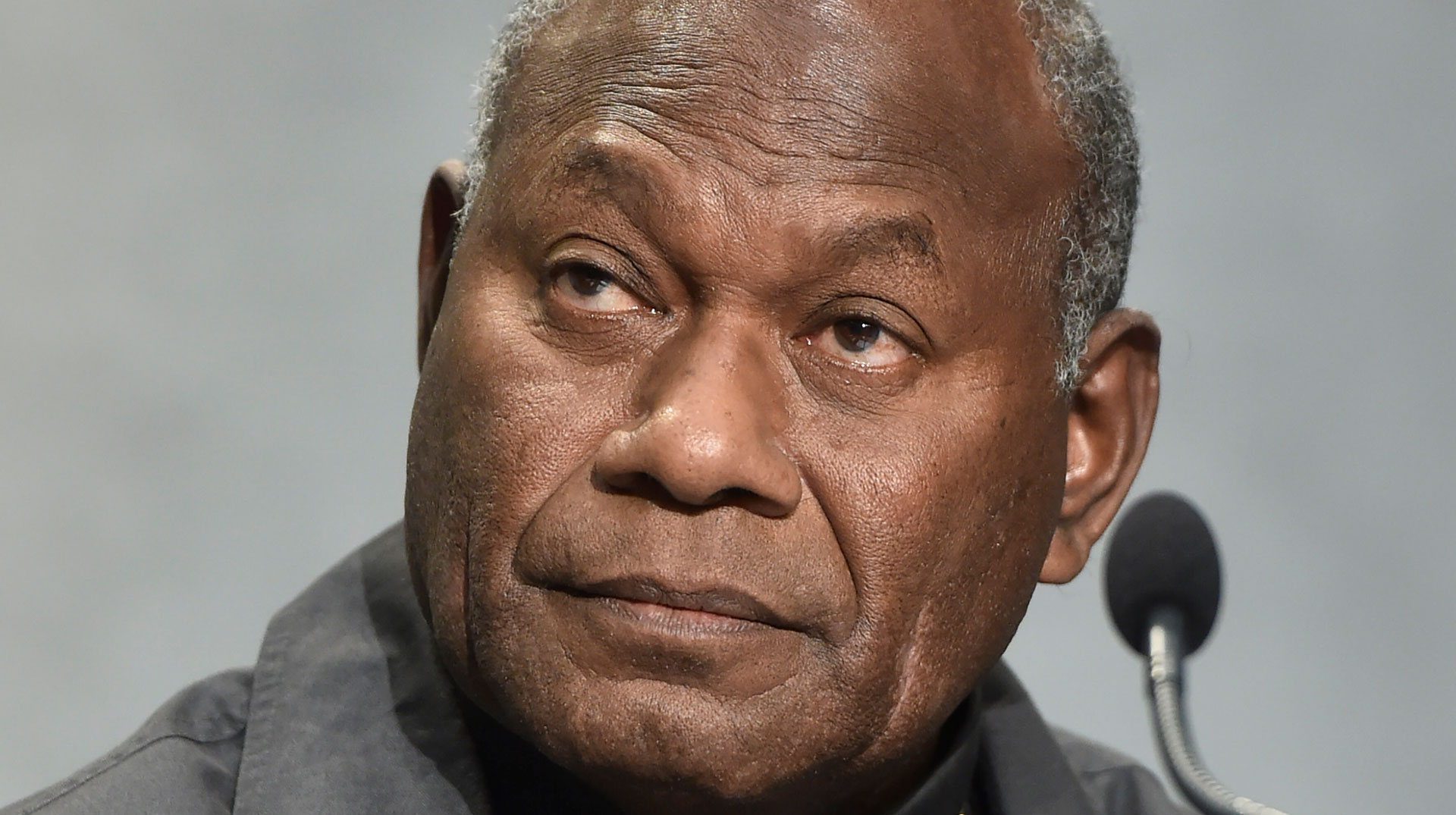
Kardinal aus Papua-Neuguinea: Wir verlieren ganze Inseln

Katholische Spendenaktion „Monat der Weltmission“ startet

Menschenrechtsaktivistin erhält Pauline-Jaricot-Preis 2024

Bedrohtes Paradies

Das Land sind wir

Menschen hoffen auf Ausweg aus Perspektivlosigkeit und Gewalt

