
Die Erben der Mission
St. Ottilien ‐ Die Missionsgeschichte im Kontext des Kolonialismus wirkt bis heute nach – und macht eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Erbe notwendig, im Austausch mit den Betroffenen Gesellschaften. Abtpräses Jeremias Schröder OSB empfiehlt, dabei „synodal“ vorzugehen.
Aktualisiert: 19.07.2024
Lesedauer:
Wenn wir vor dem Hintergrund aktueller Kolonialismusdebatten auf die Mission blicken, scheint zunächst ein Ansatz naheliegend, der im Sinne einer Bilanz nebeneinanderstellt, was da negativ und positiv zu vermerken ist. Das war auch die Aufgabenstellung für diesen Beitrag, so etwa: „Es war nicht alles schlecht – die Mission hat auch viel Gutes bewirkt.“
Solche Versuche des Aufrechnens von Licht und Schatten, von Früchten und Verderbnis durch Mission im Kolonialzeitalter sind nicht sinnlos. Ein kleinteiliger Blick hinter viele allzu glatte Kongregationsgeschichten bringt viel Neues zutage: unbekannte oder unbenutzte Quellen, Akteure, die bislang nicht wahrgenommen wurden, und zwar sowohl aus der einheimischen Bevölkerung wie auch unter den entsandten Missionaren und Missionarinnen. Neben dem quellenorientierten „Mikroblick“ hilft auch der weit ausgreifende „Makroblick“, neue Facetten dieses Missionsgeschehens des 19. und 20. Jahrhunderts sichtbar zu machen.

Kipatimu, Gründung der Missionsbenediktiner im Jahr 1908 in DeutschOstafrika (heute: Tansania)
Aber diese Art der Bilanz ist nur ein und vielleicht sogar ein recht beschränkter Weg, um zu verstehen, was es mit dieser Missionsgeschichte auf sich hat. Denn es handelt sich ja nicht um einen abgeschlossenen Krimi mit Anfang, Entwicklung und Ende. Es handelt sich um echte Geschichte, die weiterwirkt.
Selbstbewusstsein, Stolz und Dankbarkeit
Als Angehöriger eines Missionsordens darf man gelegentlich an den Jubiläumsfeiern teilnehmen, die in Afrika und anderswo veranstaltet werden, wenn sich irgendwo der Missionsbeginn an einem Ort zum 100. oder 150. Male jährt. Die Feiern sind für uns Mitteleuropäer recht lehrreich. Veranstalter sind meist die Ortskirchen und eher selten die Ordensgemeinschaften. Es handeln also die Erben der Mission, nicht ihre ursprünglichen Träger. In den Feierlichkeiten zeigt sich ein ziemlich ungebrochenes Selbstbewusstsein mit Freude, Stolz und Dankbarkeit. Die ersten Missionare werden heroisch dargestellt, mit idealisierten Porträts von lokalen Künstlern. Sie sind zu den Ahnen der einheimischen Christenheit geworden. Man wird daran erinnert, wie der Engländer Bonifatius im 19. Jahrhundert zum Patron der Deutschen werden konnte. Es gibt auch kritische Zwischentöne, die aber weniger die Anfänge der Mission behandeln, sondern Schwachstellen des gegenwärtigen christlichen Lebens. Neuerdings schwingt dann auch noch Mitleid mit der schwächelnden Christenheit in den Ursprungsländern der kolonialzeitlichen Evangelisierung mit. Diese Feiern haben volkskirchliche Gestalt. Akademische Diskurse spielen dort nur am Rande eine Rolle. Aber diese Jubiläen leisten einen nicht unwichtigen Beitrag zu unserer Frage, wie wir heute auf die Missionsgeschichte blicken, die sich im Zeitalter des Kolonialismus ereignet hat.
Durch diese Missionstätigkeit sind ja Gemeinden, Ortskirchen und ganze Gesellschaften entstanden. Die Identität und das Selbstbild von Hunderten Millionen von Menschen werden durch diese Geschichte geprägt. Die Jubiläen sind ein kleiner Ausdruck dieser Identität. Repräsentanten der einstigen Missionsträger werden dazu eingeladen, aber sie sind nur noch Gäste. Bei diesen Jubiläen feiern Gesellschaften, wie sie entstanden und gewachsen sind, in der Begegnung mit Mission und auch Kolonialismus. Sie entwerfen eine – freilich vereinfachte – Autobiografie. In diesem Akt realisieren sie Selbstwirksamkeit – agency – und machen sich und ihrer Umwelt deutlich, dass sie kraftvoll in der Zeit stehen. Natürlich ist diese Geschichte auch Konstruktion, nicht neutrale Dokumentation.

Peramiho, Gründung der Missionsbenediktiner im Jahr 1898.
Kein unkritischer Rückblick
Der selbstgestaltete Rückblick ist, trotz einer Neigung zur Heroisierung und Glorifizierung als Selbstbestätigung der eigenen Geschichte, nicht unkritisch. Es lohnt sich, genau hinzuhören, was da wirklich vorgebracht wird. Oft unterscheidet er sich von europäischen Deutungsmustern, die so oft um Fragen der Gewalt kreisen. Genannt wird dann etwa, dass die Übertragung der konfessionellen Spaltungen die Gemeinschaftlichkeit älterer sozialer Einheiten gesprengt habe; dass die Missionsmethode einiger Kongregationen eher Abhängigkeit als Selbstständigkeit gefördert habe oder auch, dass Evangelisierung doch noch an der Oberfläche geblieben sei, wie es in einer Reflexion afrikanischer Bischöfe im Gedenken an den Genozid in Ruanda heißt.
Geschichtsschreibung ist nicht nur Schilderung. Sie darf auch urteilen. Wenn diese Urteile gerecht sein sollen, müssen sie den Zeithorizont berücksichtigen. Es gab auch im 19. und 20. Jahrhundert Akteure und Organisationen, die ethisch verantwortlich, vorausblickend, klug und edel gehandelt haben, und andere, die Unrecht begangen haben, und zwar nach den Maßstäben ihrer Zeit. Und es gab unendlich viele Schattierungen zwischen diesen beiden Polen. Das ist keine neue Erkenntnis.

Sali, Gründung der Missionsbenediktiner im Jahr 1911 in DeutschOstafrika (heute: Tansania).
Die innerkirchliche Diskussion in den alten Aussendeländern muss aber außerdem noch beachten, dass hier eine geteilte Geschichte betrachtet wird. Fragen, die sich aus unserer institutionellen Gewissenserforschung ergeben, dürfen und müssen gestellt werden. Aber wir müssen auch mitbedenken, dass die Geschichte zu einer gemeinsamen Geschichte geworden ist. Es gibt keine exklusive Deutungsvollmacht. In diesem Sinne ist auch die Missionsgeschichtsschreibung eine „Kontaktzone“ geworden, wie ein Schlagwort der Kolonialismusforschung heißt. Es wäre spannend, wenn es gelänge, miteinander eine „synodale Missionsgeschichte“ zu schaffen.

Abtpräses Jeremias Schröder OSB
Der Autor
Jeremias Schröder OSB ist Abtpräses der Missionsbenediktiner von St. Ottilien.
Dieser Beitrag ist dem Jahresbericht Weltkirche 2023 entnommen, der von der Konferenz Weltkirche herausgegeben wird.

Entführtes Kulturgut kehrt aus dem Vatikan nach Kanada zurück

Frankreich gibt Madagaskar historische Menschenschädel zurück

Großes Europa, kleines Afrika – Wenn die Weltkarte verzerrt ist

Handel mit menschlichen Überresten hält auch in Deutschland an

Bundesregierung lehnt Wiedergutmachung für ehemalige Kolonien ab

„Er ließ nie zu, dass sein Katholizismus sein Lakota-Sein abschwächte"

Pflanzen und Kolonialismus – Ausstellung im Wiener Weltmuseum

Auf der Suche nach Erfüllung einer Vision
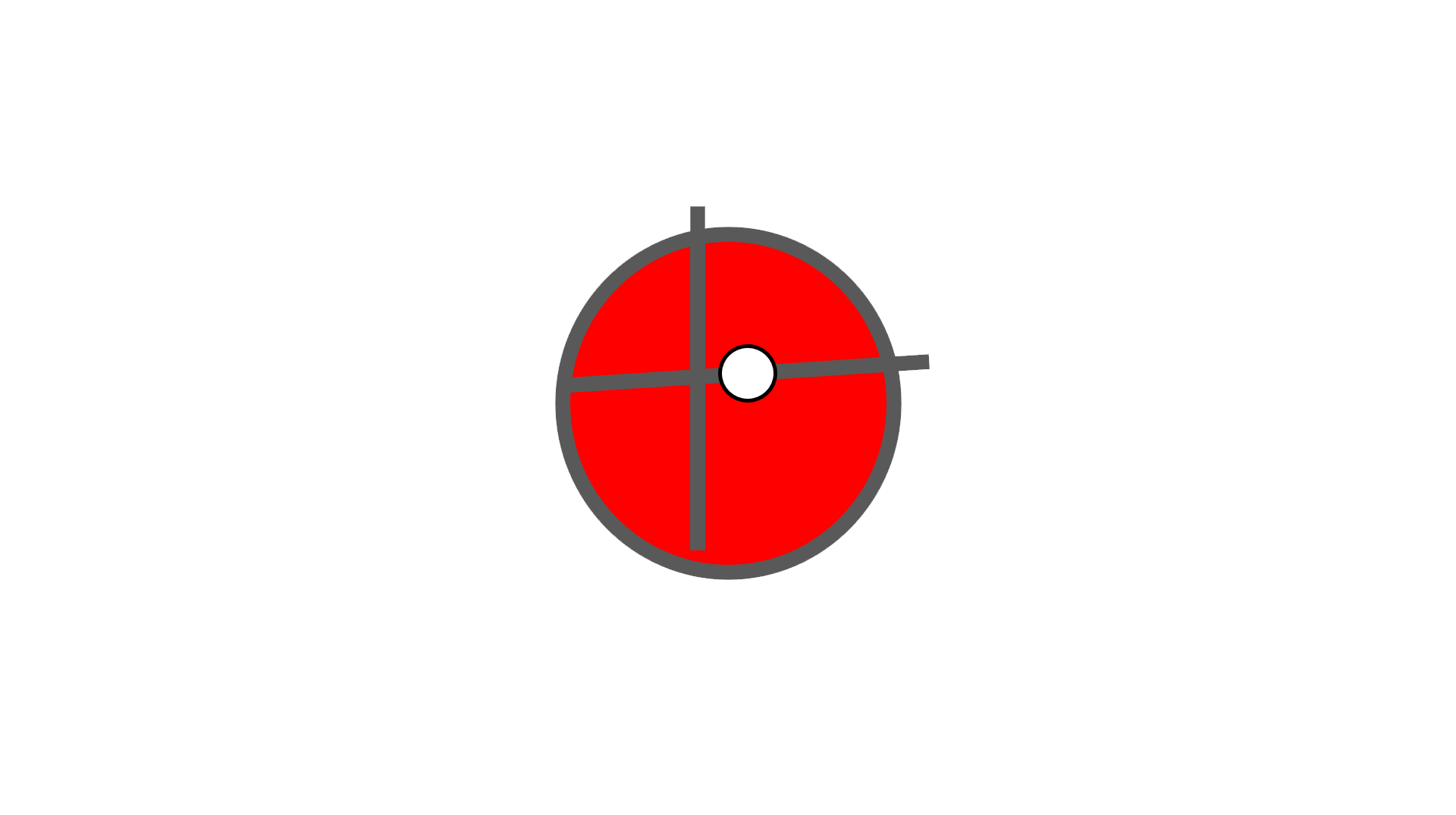
Indigene Spiritualität und christlicher Kontext – eine Schieflage?

Luke Kelly läuft von München nach Turin

Ordensleben als „Heimat ohne Grenze“



