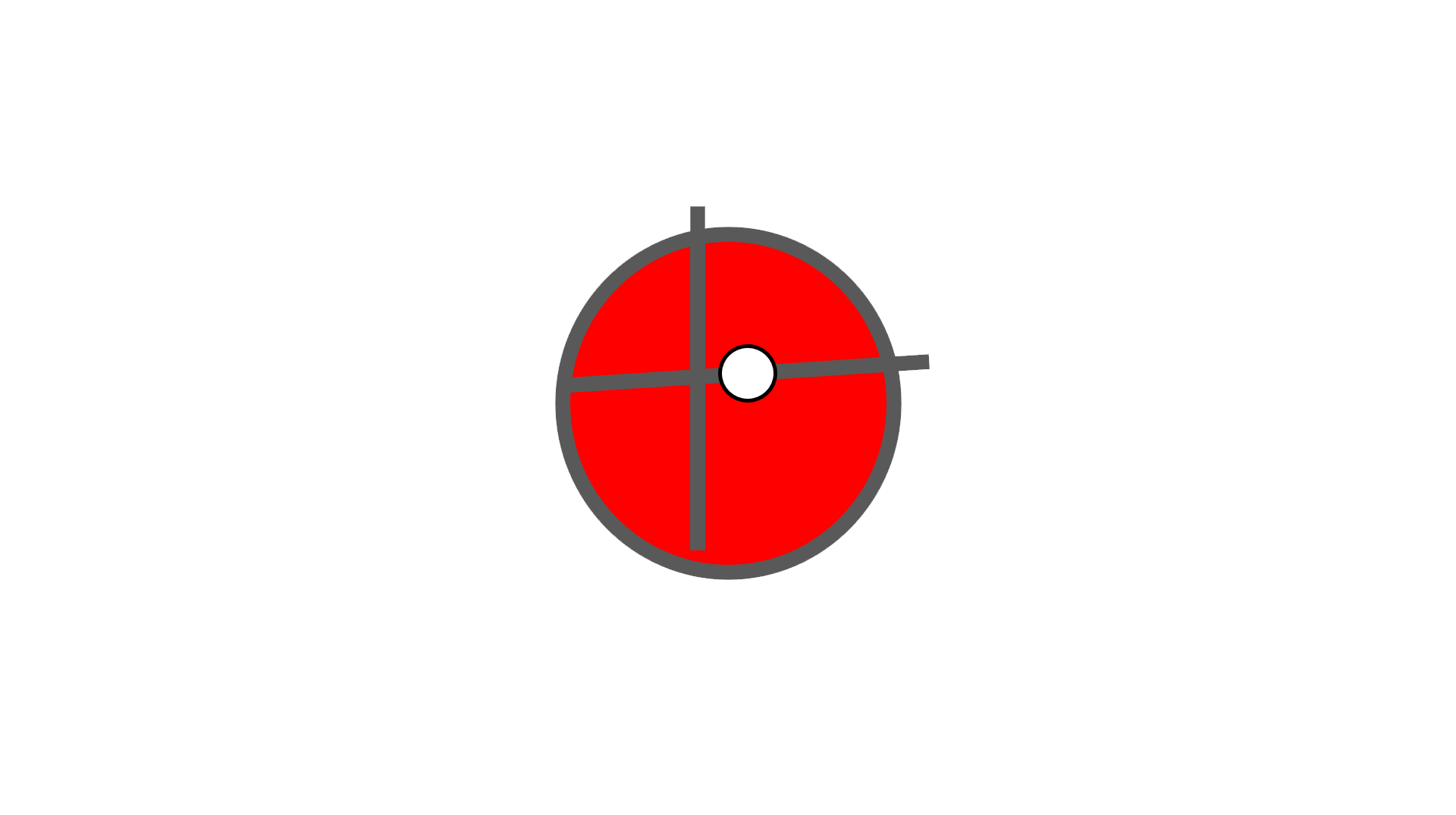Die Kirche und der Kolonialismus in Afrika
Nairobi ‐ War die Kirche Teil des europäischen Kolonialismus? Der Jesuit Dr. Anthony Egan SJ hat da eine klare Meinung. Dennoch plädiert er für eine differenzierte Betrachtung.
Aktualisiert: 23.07.2024
Lesedauer:
Die kürzeste Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Kolonialismus ist: Ja, die Kirche war Teil des europäischen Kolonialismus. Aber die Wahrheit ist komplexer. Die Beziehung variiert je nach historischer Epoche (präkolonial, kolonial und postkolonial), den vorherrschenden theologischen Prioritäten sowie den Nationalitäten und dem Grad der „Einbettung“ der Missionare in den jeweiligen kolonialen Kontext.
Sowohl die Epoche ist wichtig als auch die Stärke der jeweiligen einheimischen oder kolonialen politischen Systeme, in denen die Missionare tätig waren. Wenn lokale afrikanische Staaten wie das Königreich Bakongo (im heutigen Nordangola und im Westen der Demokratischen Republik Kongo) im 16. und 17. Jahrhundert mächtig genug waren, um diplomatische Beziehungen zu Europa aufzunehmen, neigten die Missionare zur Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Establishment. Im Königreich Bakongo unterstützten sie unter anderem Aktivitäten gegen die Sklaverei. Dies beeinflusste sogar die Haltung der zuständigen vatikanischen Behörde („Propaganda Fide“). In einer Zeit, in der sich die katholische Kirche zur Sklaverei bestenfalls ambivalent und schlimmstenfalls unterstützend verhielt, gelang es den Missionaren im Bakongo-Königreich, der Propaganda Fide zumindest eine stillschweigende Opposition zur Sklaverei abzuringen. Wenn solche Staaten jedoch zu Kolonialstaaten wurden, tendierten die Missionare dazu, die neue Ordnung zu akzeptieren, um ihre Evangelisierungsarbeit fortsetzen zu können. Mit demselben Ziel folgten sie auch den Kolonialmächten in neue Territorien.

Bereits zwei Jahre nach der Gründung des Klosters Mariannhill in der Nähe von Durban in Südafrika eröffneten die Missionare eine Schule für Jungen und im folgenden Jahr eine Schule für Mädchen (1884/5). Das Foto stammt aus dem Jahr 1897.
„Christlich“ hieß lange „europäisch“
Ein bedeutender Faktor im Verhältnis von Kirche und Kolonialismus ist die Beziehung zwischen Christentum bzw. Katholizismus und europäischer Kultur. In einer Zeit, in der der Begriff der Inkulturation selten (bis gar nicht) vorkam, waren – oft unausgesprochen, aber vielleicht unvermeidlich – Christentum und Europa eng miteinander assoziiert. Das Christentum hatte sich von einem westasiatischen/mittelöstlichen Glauben, der von griechisch-römischen Philosophien und Gesetzen geprägt und beeinflusst war, zu einer Religion entwickelt, in der das Europäische als Norm galt. Konfrontiert mit einer europäisch beherrschten Kolonialgesellschaft, vollzogen die Missionare (die selbst Europäer oder durch ihre Ausbildung europäisiert waren) diese Verschiebung mit, praktisch ohne darüber nachzudenken. Selbst dann, wenn die Missionare der Kolonialpolitik kritisch gegenüberstanden (z. B. mit Blick auf Zwangsarbeit, Rassentrennung oder gewaltförmige Beherrschung der kolonisierten Völker), wurzelte ihre Haltung großenteils in der Ansicht, dass christliche Afrikaner (oder amerikanische Indigene oder Asiaten) aufgrund ihrer Bekehrung Christen und als solche europäisch assimiliert seien.
Rassismus gegenüber einheimischen Priestern
Die Haltung der Missionare gegenüber afrikanischen Konvertiten war vielschichtig. Es herrschte das Gefühl, dass sie „zu unreif im Glauben“ seien, um mit Aufgaben wie dem Priesteramt betraut zu werden. Die wenigen Afrikaner, die ab den 1890er-Jahren geweiht wurden, machten sehr schwierige Erfahrungen der Unterordnung („Ständige Hilfspriester“) und sie begegneten teilweise offenem Rassismus. Nach Maximum Illud (1925), der Enzyklika von Benedikt XV., in der sich der Papst für einheimische Geistliche einsetzte, nahm ihre Zahl zu. Die Segregation in den Priesterseminaren in Südafrika beispielsweise wurde jedoch erst 1976 vollständig aufgehoben.
Missionare meist ambivalent gegenüber Nationalbewegungen
In Britisch-Ostafrika, insbesondere in Kenia, gab es zwar nie eine offizielle protestantische „Staatskirche“. Viele katholische Missionare hatten jedoch den Eindruck, dass die britischen Machthaber Anglikaner, Presbyterianer und andere protestantische Konfessionen bevorzugten. Trotzdem standen die meisten katholischen Missionare den afrikanischen nationalistischen Bewegungen ambivalent gegenüber.

Gerichtsverfahren im südlichen Afrika in den 1890er-Jahren. Die Beamten tragen englische Uniformen.
Von großer Bedeutung war das Ausmaß, in dem die Missionare in die koloniale Gesellschaft „eingebettet“ waren. Je mehr sie sich mit dem kolonialen Staat identifizierten, desto bereitwilliger übernahmen sie die koloniale Agenda. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass sie Europäer und in ihrer Theologie eng mit der europäischen Kultur verbunden waren. Auch die Nationalität der Missionare spielte eine wichtige Rolle. Stimmte ihre Nationalität mit der der Kolonialherren überein, so identifizierten sie sich im Allgemeinen umso eher mit dem Kolonialismus. Gehörten die Missionare hingegen einer anderen Nationalität an – und umso mehr, wenn es Spannungen mit der kolonialen Nationalität gab –, war die Identifikation mit dem Kolonialismus schwächer. Dies ging manchmal so weit, dass sich antikoloniale Gefühle manifestierten. Am deutlichsten wird dies im südlichen Afrika in der Mitte des 20. Jahrhunderts, insbesondere in Britisch-Südrhodesien und Portugiesisch-Mosambik. In beiden Ländern gab es nicht britische bzw. nicht portugiesische Missionare, die Gegner des Kolonialismus waren oder zumindest die Aufhebung der Rassentrennung und eine schrittweise volle Gleichberechtigung der afrikanischen Bevölkerung befürworteten.
Gleich vor Gott – aber …
Immer gab es unter den Missionaren interne Spannungen mit Blick auf ihre Haltung gegenüber dem Kolonialismus. Die christliche Theologie geht von der universellen Gleichheit aller Gläubigen vor Gott durch die Taufe aus. Diese Position wurde vom Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren unterstrichen. Die Missionsschulen aller Konfessionen standen im Dienst eines „zivilisatorischen“ Projekts, das als europäisierendes Projekt verstanden wurde. Dies stellte die Missionare vor die Frage: Wenn wir „afrikanische christliche Europäer“ herangezogen haben, sollten sie dann nicht genauso behandelt werden wie die europäischen Kolonialherren? Die meisten Missionare antworteten mit: „Ja“. Die Kolonialisten sagten: „Auf keinen Fall ... noch nicht ... vielleicht ein paar“.
Christen aktiv in Nationalbewegungen
In ganz Afrika – von den französischen Kolonien im Westen über die britischen und portugiesischen Kolonien im Osten bis hin zu den stark segregierten Ländern Südafrika und Rhodesien – bildeten die von der Mission ausgebildeten Christen das Fundament der afrikanischen Nationalbewegungen, die von den 1950er-Jahren bis 1994 (dem Ende der Apartheid in Südafrika) das koloniale Gebäude zum Einsturz bringen sollten.

Refektorium des früheren Trappistenklosters von Mariannhill in der Nähe von Durban/Südafrika im Jahr 1897. Damals lebten in dem 1882 gegründeten Kloster und auf den Missionsstationen in KwaZulu-Natal etwa 266 Brüder und Patres. Ihre erfolgreiche Missionsarbeit ließ sich auf Dauer nicht mit dem kontemplativen Leben des Trappistenordens vereinbaren. So wurden sie, mit Zustimmung des Apostolischen Stuhls, zur eigenständigen Kongregation der Missionare von Mariannhill.
In den postkolonialen Staaten war das Ausmaß, in dem Missionare Teil der antikolonialen Bestrebungen waren, ein Maßstab dafür, wie es der Kirche in den ersten Jahrzehnten der Unabhängigkeit erging. In Ländern wie Mosambik und Angola, in denen man die Kirche mit Portugal identifizierte, stieß sie auf ein gewisses Maß an Feindseligkeit. Wo sich die Kirche jedoch mit der Befreiung identifizierte (z. B. in Südafrika), war das Verhältnis positiver.
Es ist nicht möglich, in einem kurzen Aufsatz eine nuancierte Darstellung von Kirche und Kolonialismus in Afrika zu geben. Viele Details – einschließlich der komplexen kirchlich-kolonialen staatlichen Machenschaften in den französischen und belgischen Territorien – wurden ausgelassen. Ich hoffe jedoch, dass ich zeigen konnte, wie vielschichtig das Problem ist. Bis heute beeinflusst das Thema die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Afrika.
Der Autor
Dr. Anthony Egan SJ lehrt Moraltheologie und Geschichte am Hekima University College Nairobi, Kenia.

Dr. Anthony Egan SJ
Dieser Beitrag ist dem Jahresbericht Weltkirche 2023 entnommen, der von der Konferenz Weltkirche herausgegeben wird.

Entführtes Kulturgut kehrt aus dem Vatikan nach Kanada zurück

Frankreich gibt Madagaskar historische Menschenschädel zurück

Großes Europa, kleines Afrika – Wenn die Weltkarte verzerrt ist

Handel mit menschlichen Überresten hält auch in Deutschland an

Bundesregierung lehnt Wiedergutmachung für ehemalige Kolonien ab

„Er ließ nie zu, dass sein Katholizismus sein Lakota-Sein abschwächte"

Pflanzen und Kolonialismus – Ausstellung im Wiener Weltmuseum

Auf der Suche nach Erfüllung einer Vision