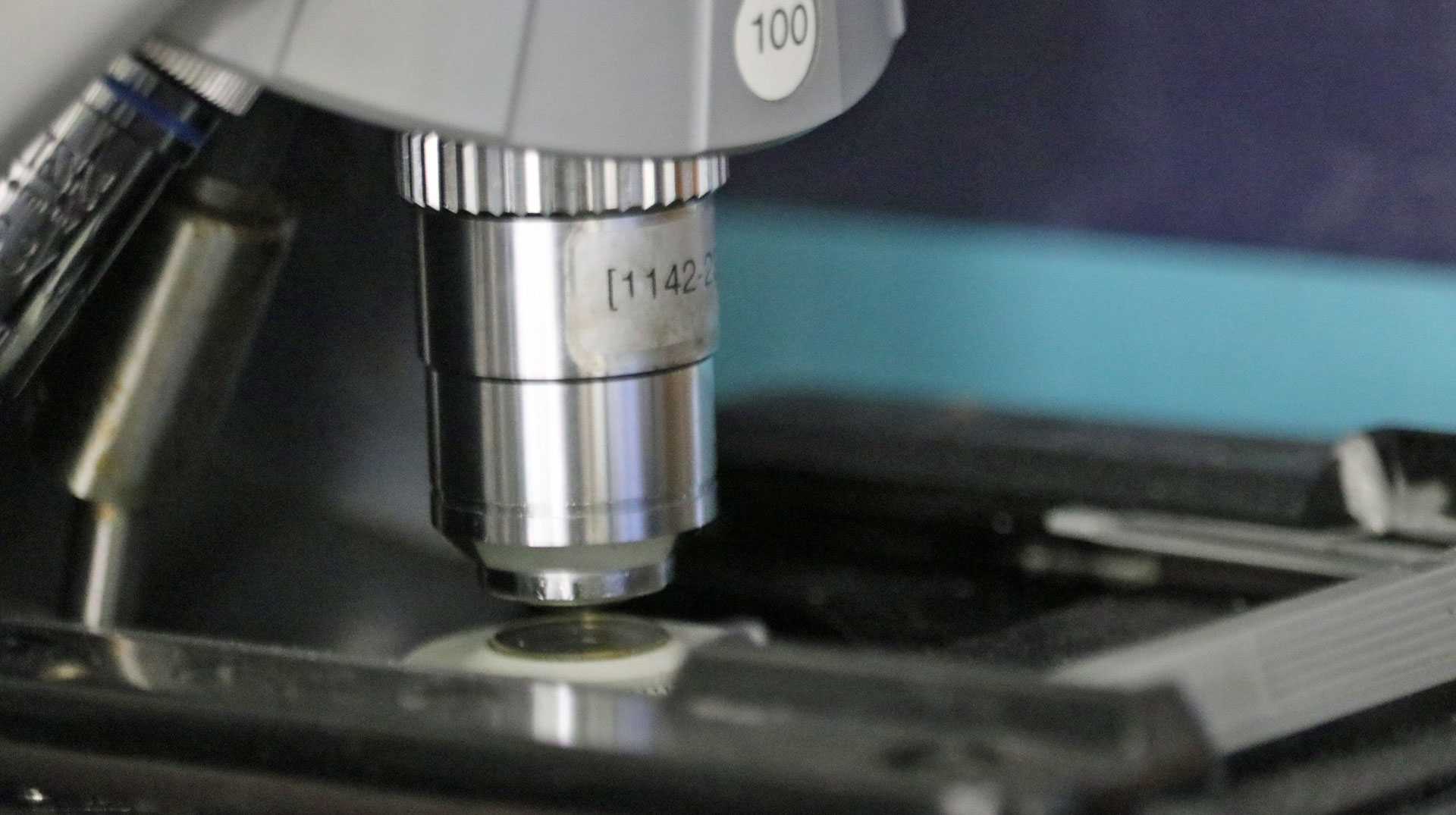„Ohne Gesundheit keine Entwicklung“
Das Missionsärztliche Institut in Würzburg (MI) hat Politiker und Verantwortliche in der Entwicklungszusammenarbeit aufgefordert, das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt der ab 2015 geltenden Nachfolgeagenda der Millenniums-Entwicklungsziele zu stellen. Gesundheit sei nicht nur ein zentrales Ziel, sondern auch ein Indikator für nachhaltige und gerechte Entwicklung, heißt es in einer Stellungnahme , die Vertreter der Fachstelle am Dienstag, 3. September, in Würzburg vorstellten.
Aktualisiert: 01.12.2022
Lesedauer:
Der Bamberger Erzbischof und Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Ludwig Schick, forderte, der Gesundheitsversorgung und dem Aufbau von Gesundheitssystemen mehr Priorität einzuräumen als bisher.
Schick kritisierte, staatliche Entwicklungshilfe fließe nur zu einem geringen Teil in Gesundheitsförderung. Die „sehr verkürzte Sicht der Regierung auf Entwicklungshilfe“ schlage in absehbarer Zeit auf Deutschland zurück. In Afrika säßen bereits Millionen von Menschen auf dem Sprungbrett nach Europa.
Nach Aussage des MI-Vorstandsvorsitzenden Prof. August Stich tritt bei der Diskussion um Gesundheit der technische Aspekt immer mehr in den Vordergrund, während die Debatte um Werte vernachlässigt werde. In der Einschätzung von kirchlichen Hilfswerken verliere Gesundheit zunehmend an Bedeutung. Schick unterstrich, Gesundheit gehöre unabdingbar zur Mission der Kirche.
„Menschrecht auf Gesundheit anerkennen“
Das Institut fordert in seinem Appell unter anderem, das Menschenrecht auf Gesundheit als Gemeinschaftsaufgabe aller Staaten verbindlich anzuerkennen. Noch nicht erreichte Millenniums-Entwicklungsziele wie die Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit oder der universelle Zugang zur Behandlung und Prävention von HIV/Aids müssten schneller umgesetzt werden. In die Entwicklungsagenda aufgenommen werden soll nach dem Willen des Instituts auch eine bessere Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten und psychiatrischer Störungen.

Die zukünftige Entwicklungsagenda müsse faire, gerechte und verbindliche Regeln für einen Finanzierungsbeitrag aller Staaten zur Entwicklung und speziell zur Gesundheit festlegen. Das bedeute vor allem, bestehende Verpflichtungen zu erfüllen wie das Ziel, mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit insgesamt und 0,1 Prozent für Gesundheitsförderung bereitzustellen. Als wirtschaftlich privilegierte Nation müsse Deutschland auf allen relevanten Gebieten zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit sein, damit dieses Grundrecht keinem Menschen vorenthalten werde.
Nach den Worten des MI-Referenten und Coautors der Studie, Dr. Klemens Ochel, bestehen Wechselbeziehungen zwischen Gesundheit und allen Bereichen zukünftiger Entwicklung, die oft von Aktivisten der einzelnen Bereiche und der Politik übersehen werden. „Was hat beispielsweise ein Kind von einem besseren Zugang zu Bildung, wenn es vor dem fünften Lebensjahr an einer vermeidbaren Erkrankung stirbt?“ Die Stellungnahme betont, Gesundheit sei nicht nur durch soziale Grunddienste zu erreichen. „Ohne Gesundheit wird es keine Entwicklung geben.“ Um Infektionskrankheiten wie HIV/Aids, Malaria oder Tuberkulose zu bezwingen, bedürfe es größerer Anstrengungen als bisher.
Schwere Krankheiten wegen fehlender Ressourcen
In dem Papier kritisiert das Institut unter anderem, Nutzen und Kosten von Gesundheit seien sowohl im internationalen Vergleich als auch innerhalb vieler Länder höchst ungleich und ungerecht verteilt. Fehlende Ressourcen sowie soziale Benachteiligung insbesondere von Frauen und Kindern erhöhten das Risiko für schwere Krankheiten und ihre Folgen. Internationale Standards für globale Märkte seien verbindlich vereinbart worden, während Grundprinzipien für das soziale Zusammenleben wie die Überwindung von Ungerechtigkeit und Armut, die Zurückdrängung von Hunger und Krankheit sowie der Schutz der Menschenrechte weit weniger beachtet worden seien.
An die Kirche appelliert das Missionsärztliche Institut, den Dialog mit denjenigen zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen und staatlichen Akteuren zu intensivieren, die sich für eine Verbesserung der globalen Gesundheitssituation einsetzen. Nach einer Bestandsaufnahme des Päpstlichen Rats für die Gesundheitspastoral betreibe die katholische Kirche 25 Prozent aller Gesundheitseinrichtungen weltweit, darunter mehr als 5.000 Krankenhäuser und fast 18.000 Gesundheitszentren. Bisher würden kirchliche Gesundheitsdienste und Programme in ressourcenarmen Ländern aber noch unzureichend mit nationalen wie internationalen Geldern unterstützt.
Von Elke Blüml
Missionsärztliches Institut Würzburg
Das Missionsärztliche Institut Würzburg ist eine Organisation christlicher Gesundheitsfachkräfte, die sich für eine ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitsarbeit in der Einen Welt engagieren. Das Institut ist die einzige katholische Fachstelle für Internationale Gesundheit in Deutschland und seit 1922 weltweit aktiv.
WHO erklärt Ebola-Ausbruch im Kongo für beendet

UN-Organisationen warnen vor Rückschritt im Kampf gegen Aids

WHO: Weniger Tuberkulosefälle, aber weitere Anstrengungen nötig

Wissenschaftler warnen: Kinderlähmung bleibt globales Risiko

Anzeichen für Ebola-Eindämmung in der Demokratischen Republik Kongo
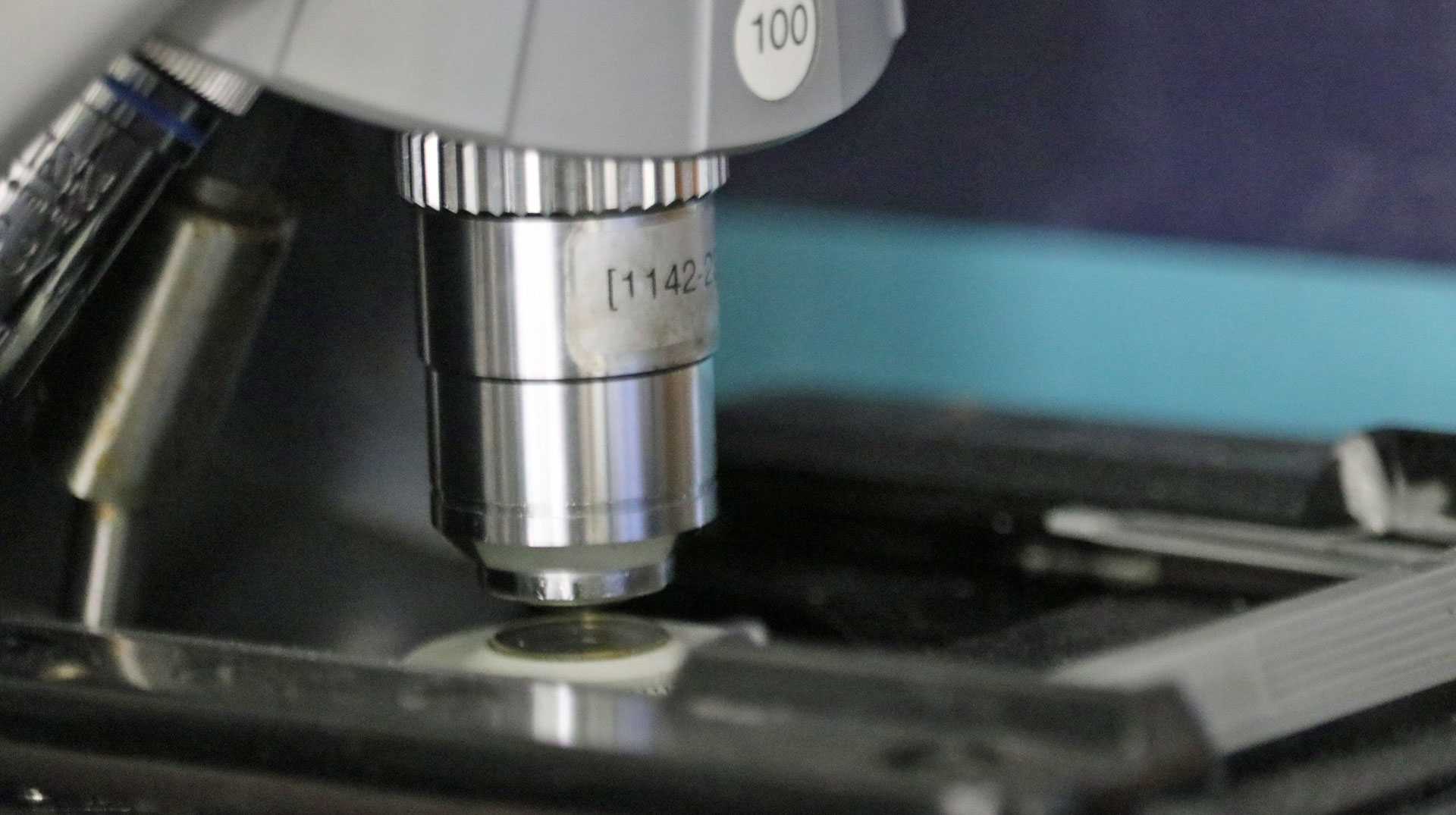
Bericht: Weltweit rund 1,3 Millionen Tote durch Tuberkulose

Neuer Ebola-Ausbruch im Kongo
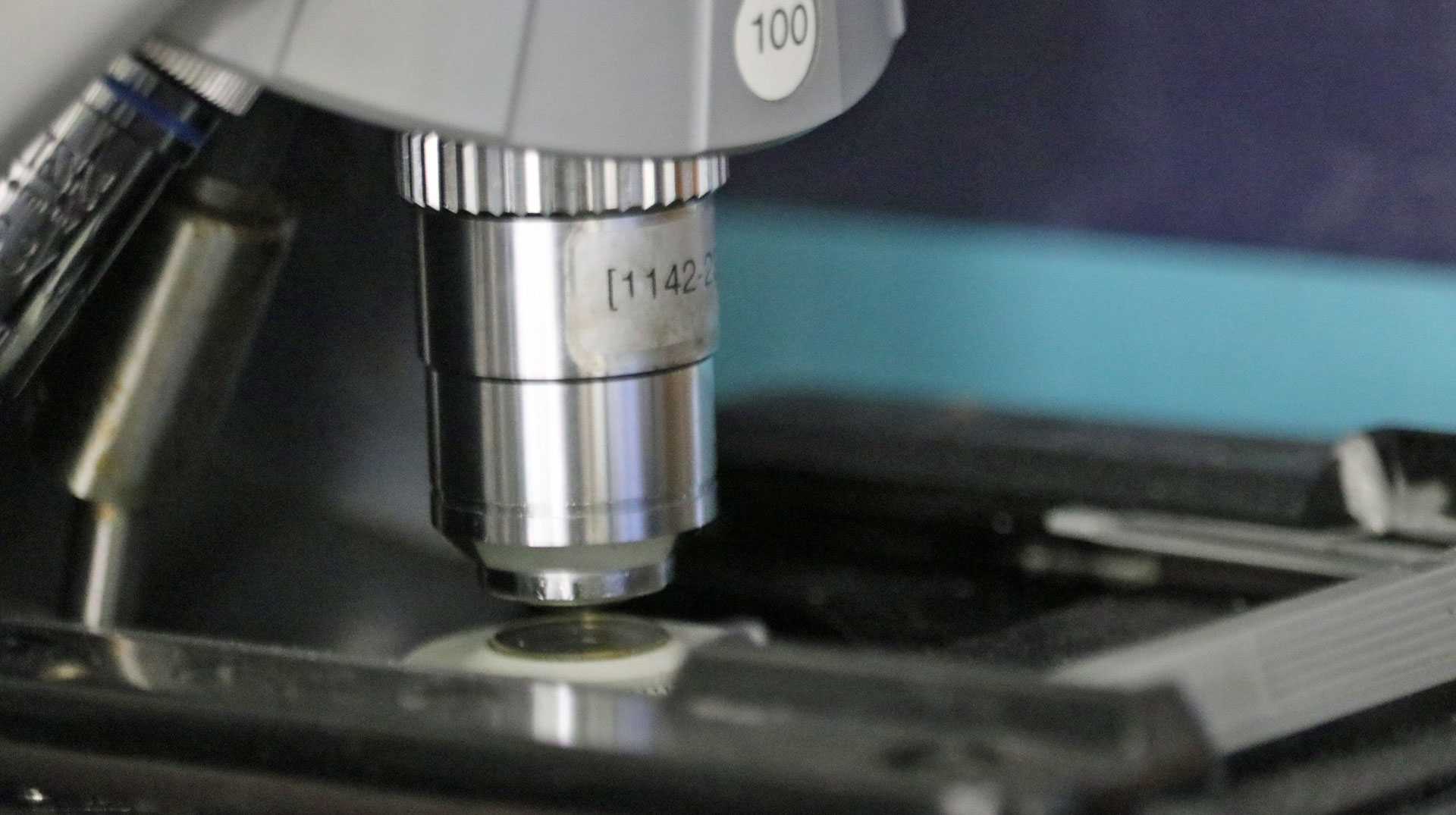
Medmissio: Gesundheitsversorgung weltweit nicht gefährden

Früherer Chefarzt der Missionsärztlichen Klinik Würzburg verstorben

Weltweit 1,3 Millionen HIV-Neuinfizierte – Mittel brechen weg

Neue Corona-Welle in asiatischen Ländern