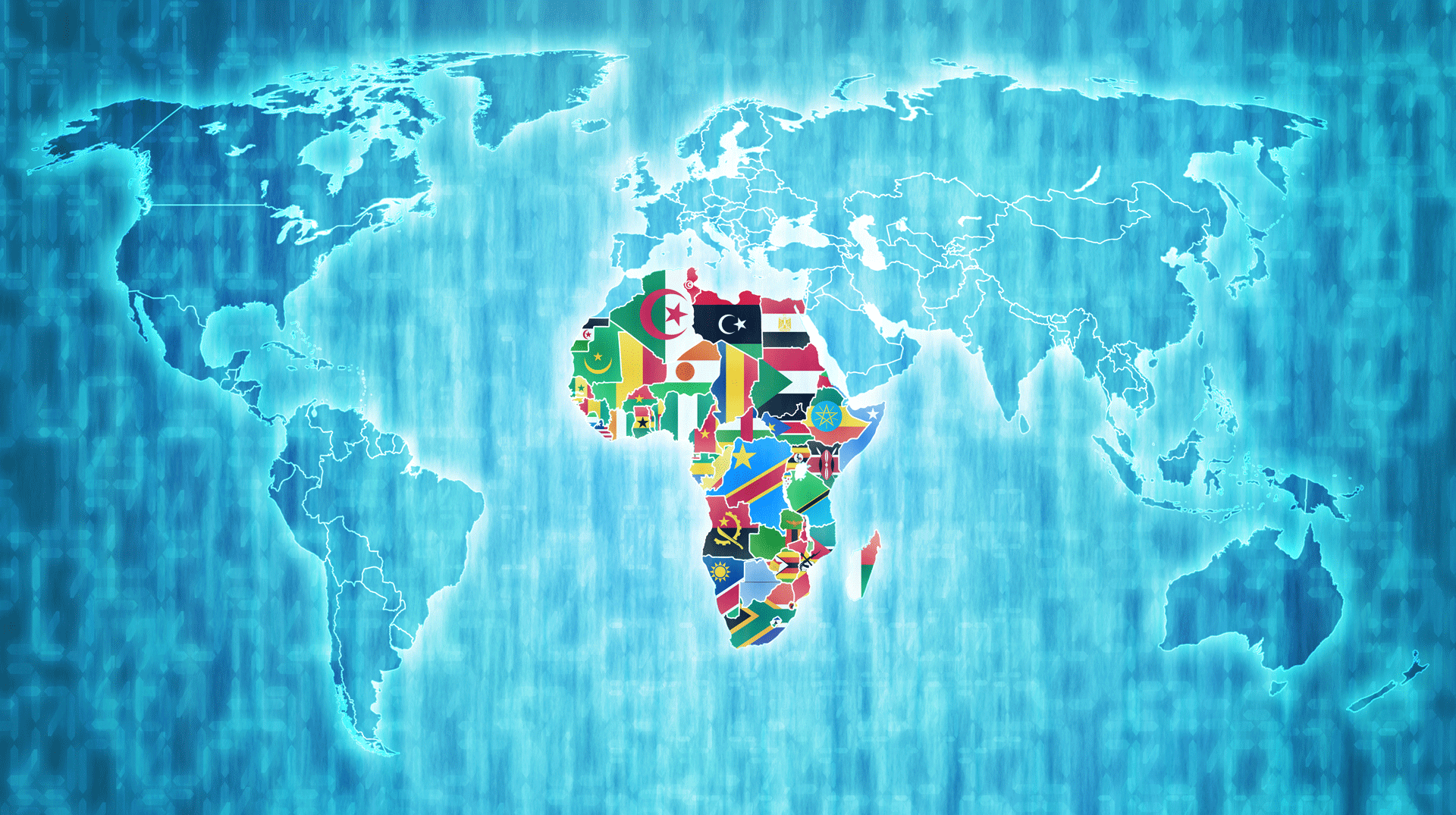Viele Präsidenten in Afrika halten sich seit Jahrzehnten an der Staatsspitze
Abidjan/Bonn ‐ Ein Präsident wird abgewählt? In zahlreichen afrikanischen Ländern ist das undenkbar. Alten Staatschefs gelingt es, sich über Jahrzehnte an der Macht zu halten. Fallen sie, haben sie schließlich viel zu verlieren.
Aktualisiert: 04.08.2025
Lesedauer:
Eine Überraschung war es nicht: Ende Juli kündigte Alassane Ouattara an, bei der Präsidentenwahl in der Elfenbeinküste erneut zu kandidieren. Trotzdem waren ihm die Schlagzeilen sicher: Gewählt wird in dem westafrikanischen Land zwar erst am 25. Oktober. Doch der Wahlsieger steht nun quasi schon fest.
Dabei ist Ouattara, ein promovierter Wirtschaftswissenschaftler, 83 Jahre alt und seit Ende 2010 an der Macht. Die Wahlen damals waren spektakulär wie umstritten und stürzten das Land in eine schwere Krise mit mehr als 3.000 Toten. Laut Wahlkommission hatte er in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Laurent Gbagbo (80) die absolute Mehrheit geholt. Der Verfassungsrat sah jedoch Gbagbo als Sieger, und das Land hatte bis zu dessen Festnahme im April 2011 zwei Präsidenten.
Ouattara galt als Favorit des Globalen Nordens – wirtschaftsnah, eloquenter und umgänglicher als Gbagbo. Lob erhielt er 2020 für seine Ankündigung, nicht erneut zu kandidieren. Eine Verfassungsreform aus dem Jahr 2016 sieht maximal zwei Amtszeiten vor, gezählt werden aber nicht jene aus der Zeit vor der Reform. Eine solche Änderung und Auslegung wird als Verfassungs-Staatsstreich bezeichnet. Doch dann entschied Ouattara sich um. Trotz monatelanger aufgeheizter Stimmung in Hochburgen der Opposition wurde er erneut vereidigt.
Noch ist es ruhig, wofür die Regierung aber vorgesorgt hat: Seinem mutmaßlich erfolgreichsten Herausforderer Tidjane Thiam (63) wurde im April die Kandidatur mit der Begründung verweigert, einst als Student in Frankreich die französische Staatsbürgerschaft angenommen zu haben. Trotz einer Aufgabe dieser wurde er verklagt und aus dem Wahlregister gestrichen. Auch weitere Oppositionspolitiker dürfen nicht antreten.
Hinter vielen afrikanischen Präsidenten steht ein enormer Apparat. Nach Einschätzung der US-amerikanischen Denkfabrik Council on Foreign Relations hätten vor allem kleptokratische Amtsinhaber große Anreize, im Amt zu bleiben. „Sie könnten ihren Reichtum verlieren, wenn sie die Macht verlieren, und möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden“, schreiben die Experten.
Auch werden Wahlkämpfe privat finanziert. Für Geldgeber handelt es sich um eine Investition, für die man eine Gegenleistung erwartet, etwa eine Bevorzugung bei Verträgen und Zuschläge für Bauvorhaben.
Ein weiterer Vorteil der Macht: Familienmitglieder lassen sich in Regierung und Verwaltung unterbringen. So geschehen im vergangenen Jahr in der Elfenbeinküste, als Ouattara seinen jüngeren Bruder Tiéné Birahima zum Verteidigungsminister ernannte.
Die mächtigen politischen Zirkel sind klein
Proteste dagegen gibt es kaum. Laut einer Untersuchung der panafrikanischen Forschungsgruppe Afrobarometer ging 2022 nicht einmal jeder zweite befragte Afrikaner (44 Prozent) davon aus, mit Wahlen unerwünschte Politiker abzusetzen. Auch haben viele Oppositionspolitiker einst auf der Seite der Macht gestanden; die mächtigen politischen Zirkel sind klein und elitär, die Chancen einer politischen Karriere äußerst gering.
Dazu kommt vielerorts ein schwaches Justizsystem, in dem allenfalls Oppositionellen hohe Strafen drohen. So wurde der einstige Ministerpräsident der Elfenbeinküste, der längst in Ouattaras Ungnade gefallene Guillaume Soro, 2020 in einem Korruptionsprozess zu 20 Jahren Haft verurteilt – und durfte deshalb im selben Jahr nicht für das Präsidentenamt kandidieren.
Die Elfenbeinküste, größte Volkswirtschaft im frankophonen Westafrika mit knapp 30 Millionen Einwohnern, ist keine Ausnahme. Jüngst kündigte Paul Biya in Kamerun in Zentralafrika, der mit 92 Jahren längst ältestes Staatsoberhaupt weltweit ist, seine Kandidatur für den 12. Oktober an. An der Macht ist er seit 1982. Schon vor sieben Jahren war er im Wahlkampf so gut wie nie zu sehen.
Mit einem Durchschnittsalter von 18,9 Jahren fühlt sich für die große Mehrheit der knapp 31 Millionen Einwohner Biya mehr als Urgroßvater denn Großvater an. Die Perspektive der Jugend ist schlecht: Knapp 40 Prozent der 15- bis 35-Jährigen sind arbeitslos. Fast jeder vierte Hochschulabsolvent hat laut der Internationalen Organisation für Migration Schwierigkeiten, eine dauerhafte Arbeit zu finden.
Doch zu Protesten kommt es erst gar nicht. Die Nichtregierungsorganisation Freedom House bezeichnet Kamerun als „nicht frei“. Politische Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit werden systematisch unterdrückt. Gerade kritisierte Human Rights Watch den Ausschluss des bekanntesten Oppositionskandidaten Maurice Kamto. Die Opposition wird damit bedeutungslos, ist oft aber auch selbst innerlich zersplittert.
Für Demokratie auf dem afrikanischen Kontinent macht sich die 2006 gegründete Mo-Ibrahim-Stiftung des gleichnamigen britisch-sudanesischen Mobilfunkunternehmers stark. Eigentlich würde sie gerne jährlich einen ehemaligen Staats- oder Regierungschef für gute Regierungsführung auszeichnen. Ein Kriterium lautet: Die durch die Verfassung geregelte Amtszeit darf nicht überzogen werden. Doch bisher gab es lediglich sechs Preisträger, letztmalig im Jahr 2020.

Das erwartet Afrika 2026

Kirchenführer warnen vor EU-Afrika-Gipfel vor Neo-Kolonialismus

Afrikas letzte Kolonie? Die Westsahara als politischer Spielball

Missio: Kriege in Ostafrika zu wenig beachtet

Afrikas Bischöfe fordern gerechte Klimafinanzierung und Abkehr von fossilen Energien

Großes Europa, kleines Afrika – Wenn die Weltkarte verzerrt ist

Misstrauen vor Präsidentenwahl in der Elfenbeinküste
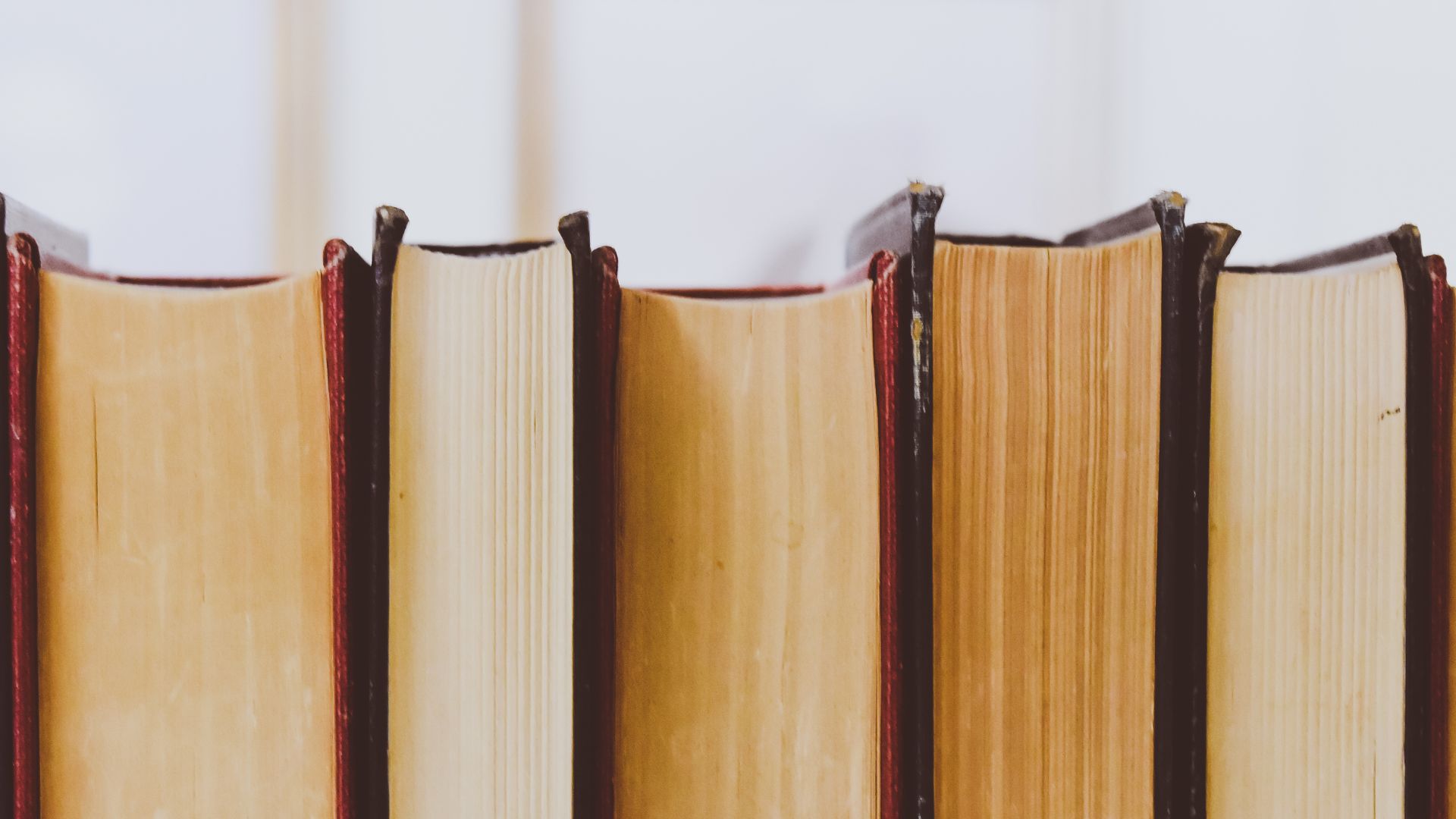
Debütroman aus der Elfenbeinküste – Gemeinsam für die Zukunft kämpfen