
Der Franziskus-Kontinent Lateinamerika ist in rasantem Wandel
Bonn ‐ Franziskus hat seinen Kontinent und sein Heimatland Argentinien geliebt. Er hat hart für ihn gekämpft; auch weil er die Gefahren für dessen Zukunft erkannte. In Argentiniens Parteipolitik wollte er nicht einsteigen.
Aktualisiert: 05.05.2025
Lesedauer:
Lateinamerika heißt auch der „katholische Kontinent“. Doch wäre es Illusion – wie man spätestens seit der Amtszeit von Papst Franziskus weiß -, einen gesamten Subkontinent als kulturellen oder gesellschaftlichen Monolithen wahrzunehmen. Lateinamerika, das ist ein Gesamt von Ländern wie in Europa etwa Albanien und Norwegen, die Schweiz und Russland.
Die katholische Kirche in Lateinamerika hängt zwischen Baum und Borke. Einerseits wurden in westlicher orientierten Ländern wie Chile oder Mexiko kirchliche Missbrauchsskandale von teils großem Ausmaß aufgedeckt. Zugleich schlagen vor allem soziale Nöte gnadenlos zu, die noch verstärkt wurden durch die Corona-Pandemie. In ihrem Kampf gegen Not leidet die Kirche auch unter gravierendem Priester- und Seelsorgermangel sowie der Abwerbung von Gläubigen durch Sektenkirchen und unseriöse Heilsversprecher.
Mehr als 500 Millionen und damit über 40 Prozent der Katholiken weltweit leben in dieser Region, die maßgeblich durch vier Jahrhunderte spanischer und portugiesischer Kolonialgeschichte geprägt ist.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte für Lateinamerikas Ortskirchen vielfache Umbrüche. Die traditionelle Allianz zwischen Kirchenoberen und herrschenden Eliten wurde aufgebrochen: Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) und die „Theologie der Befreiung“ auf der einen sowie zahlreiche blutige Bürgerkriege und Militärdiktaturen auf der anderen Seite brachten die Kirche zu einer „vorrangigen Option für die Armen“ und Unterdrückten. Dafür gerieten Bischöfe und Menschenrechtler ins Visier gedungener Mörder.
Die Sicht auf die Theologie der Befreiung ist bis heute mit Ideologisierungen behaftet und umstritten. Für Johannes Paul II. (1978-2005), den Papst aus dem kommunistisch regierten Polen, war der Gedanke an eine Verquickung von Christentum und Marxismus unerträglich. Auch sein oberster Glaubenshüter Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. (2005-2013), dachte im Umgang mit der Befreiungstheologie vor allem europäisch.
Ein theologischer „Rollback“ war die Folge: Lateinamerikas Bischöfe standen zwischenzeitlich deutlich weniger „links“ als die der 80er Jahre. Zugleich fanden Botschaften der lateinamerikanischen Theologie Eingang in die offizielle Sozialverkündigung der Gesamtkirche. Papst Franziskus (2013-2025) war in diesem Sinne ein linker Lateinamerikaner auf dem Papstthron („Diese Wirtschaft tötet!“). Seine vertrauliche Nähe zu Linkspolitikern seines Kontinents ist ihm im Westen oft angelastet worden.
Nach wie vor eine starke Stimme
So verschieden die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kirchliche Lage in den Ländern des Subkontinents ist: In den vergangenen Jahren war in vielen Staaten Lateinamerikas, ausgehend von Venezuela, Ecuador, Nicaragua und Bolivien – zumindest mit Blick auf die Selbstbeschreibungen der entsprechenden Regierenden – ein politischer Linksruck zu verzeichnen, den die katholische Kirchenführung dort oft kritisch begleitete. Mancherorts sind sogar Bischöfe die einzig vernehmbare Opposition, wie etwa auf Kuba oder in Venezuela und Nicaragua. In einigen Staaten, beispielsweise El Salvador oder Brasilien, folgte auf den Linksruck ein Schwenk nach ganz rechts außen.
Dabei legen die Kirchenführer Wert auf die Feststellung, ihnen gehe es nicht um Parteipolitik, sondern um die Grundpfeiler gesellschaftlichen Zusammenlebens: Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde. Weitere Positionen im Sozialen Diskurs sind der Schutz von Migranten, der traditionellen Familie, Lebensschutz oder der Kampf gegen Drogenkriminalität.
Ein anhaltender Trend auf dem Kontinent ist die fast explosionsartige Ausbreitung evangelikaler Gemeinschaften. Einst aus den USA massiv befördert als ein Gegengewicht zum „linken“, befreiungstheologisch geprägten Katholizismus, gewannen diese Gruppierungen mit massiver medialer Präsenz, einer rasant schnellen „Ausbildung“ von Predigern und meist haltlosen Heilsversprechen großen Zulauf; vor allem dort, wo die „normale“ katholische Pfarrseelsorge durch Priestermangel an die Grenzen ihrer Ressourcen stößt: in den Favelas, bei Verzweifelten und Heilsuchenden. Oder bei sozialen Aufsteigern, die sich durch ihre verbesserte Lebenssituation in der katholischen Kirche mit ihrem Blick auf die Ränder der Gesellschaft nicht mehr zu Hause fühlen.
Tiefe Religiosität ist in Lateinamerika ein so allgemeines wie alltägliches Phänomen. Der Glaube ist hier viel stärker emotional geprägt. Auch kritische Ansätze wie Öko- und feministische Theologien sind stark am wachsen. Gleichzeitig ist Gemeinde oft noch tatsächlich Ort gemeinsamen Lebens, Lernens und Teilens.
Hier gibt es „Kleine Gruppen“, Basisgemeinden, Hauskirchen, für die sich Familien zusammenschließen, um Gottesdienst zu feiern; in die Familienkatechese sind alle Altersgruppen eingebunden. Junge charismatische Gemeinschaften unterhalb von „kirchlichen Strukturen“ zu fördern, war ein Ansatz der Versammlung von Aparecida 2007, wo der Lateinamerikanische Bischofsrat CELAM – unter Federführung des späteren Papstes Franziskus – eine neue „kontinentale Mission“ beschloss.
In den vom Modernisierungsschub erfassten Ländern Lateinamerikas hat die katholische Kirche nach wie vor eine starke Stimme. Sie hat aber täglich zu kämpfen – und vielfältige Vermittlungsprobleme.
Adveniat: Mercosur-Abkommen atmet Geist kolonialer Abhängigkeiten

Trumps Anti-Drogen-Strategie wirft in Lateinamerika Fragen auf

Eklat in Costa Rica: Präsident wettert gegen Erzbischof

Adveniat-Chef Maier: Weltklimakonferenz braucht konkrete Ergebnisse

Früherer Adveniat-Geschäftsführer Spelthahn gestorben

Streit um Amnestiegesetz spaltet Peru
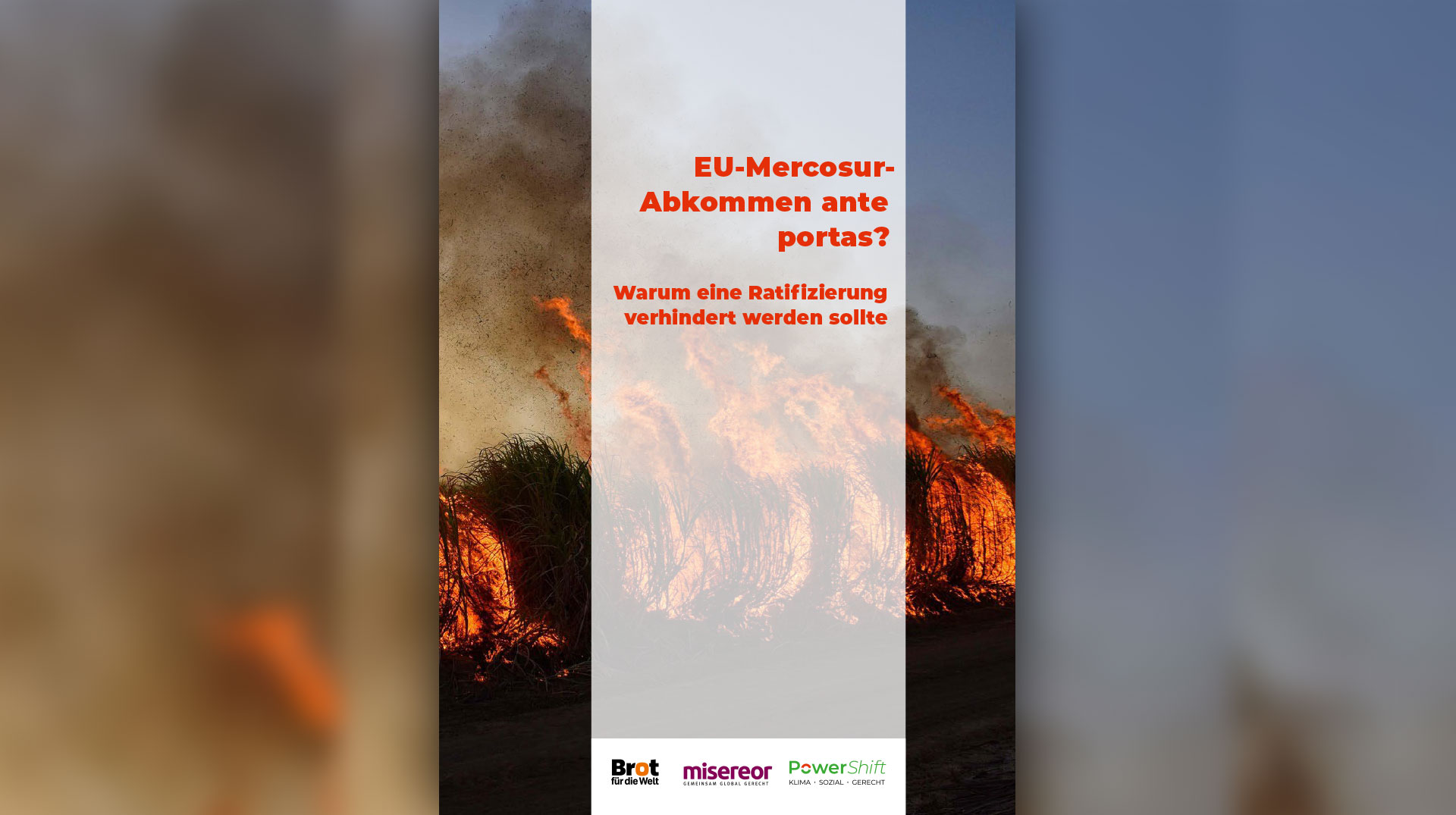
Hilfswerke: EU-Mercosur-Abkommen hebelt Klimaschutz aus

Organisation Amerikanischer Staaten vor dem Ende?

