
Philippinen besonders betroffen: Weltrisikobericht blickt auf Katastrophengefahr
Berlin ‐ Wenn Starkregen für Überschwemmungen sorgt, hat das Folgen für Menschen und die betroffene Infrastruktur. Wie schwerwiegend diese Folgen sind, hängt allerdings von weiteren Faktoren ab. Manche davon sind menschengemacht.
Aktualisiert: 24.09.2025
Lesedauer:
Die Spuren der Flut sind auch mehr als vier Jahre danach unübersehbar. Mitte Juli 2021 verwandelte sich die Ahr, ein kleiner Zufluss des Rheins südlich von Bonn, aufgrund hoher Niederschläge in einen reißenden Strom. Das Wasser riss 135 Menschen in den Tod, zerstörte Brücken und Straßen, schwemmte ganze Häuser fort. Immer noch klaffen in dem idyllischen Tal Lücken, wo einst Gebäude standen. Die Eisenbahnlinie ist noch nicht wieder aufgebaut.
Andererseits ist vieles wieder intakt. Jetzt, im Herbst, strömen die Besucher aus nah und fern in das größte zusammenhängende Rotweinanbaugebiet Deutschlands. Trotzdem: Im Zeitraum zwischen 2020 und 2024 gilt die Flutkatastrophe an der Ahr und in den benachbarten Regionen mit 59 Milliarden US-Dollar Schäden als folgenschwerste Überschwemmung - ungeachtet der vielen Toten und Verletzten. Und ungeachtet der Tatsache, dass Menschen nicht nur Hab und Gut, sondern mitunter auch ihre Heimat verloren.
Das ist ein Grund, weswegen der vom Bündnis Entwicklung Hilft und dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum vorgelegte Weltrisikobericht in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf das Thema Flut und Überschwemmungen legt. Diese zählen laut Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wird, zu den verheerendsten extremen Naturereignissen. Zwischen 2000 und 2016 waren davon 1,6 Milliarden Menschen weltweit betroffen. Wie sehr, das hängt auch von anderen Faktoren ab wie dem Grad an sozialer Ungleichheit oder dem Zustand der jeweiligen Gesundheitssysteme.
Das heißt konkret: In einem reichen und von Phänomenen wie Starkregen seltener betroffenen Staat ist die Gefahr für die Einwohner geringer, Opfer einer Katastrophe zu werden, als in ärmeren und exponierteren Ländern. Führt man sich vor Augen, wie sehr Deutschland mit den Folgen der Ahrflut von 2021 zu kämpfen hatte, kann man erahnen, wie die Lage in anderen Teilen der Welt aussieht. Der zusammen mit dem Bericht präsentierte Weltrisikoindex führt Deutschland auf Platz 95 und damit im Mittelfeld der 193 gelisteten Staaten.
Deutschland im Mittelfeld
Angeführt wird dieses Ranking von den Philippinen. Der südostasiatische Inselstaat ist den Angaben zufolge einer Vielzahl natürlicher Gefährdungen ausgesetzt. Dazu gehören Vulkanausbrüche und Erdbeben. Fluss- und Küstenüberflutungen nähmen in der Risikoanalyse jedoch eine zentrale Rolle ein. Die Gefahren seien dort besonders hoch, wo das Land flach und dicht besiedelt sei und die Infrastruktur zur Entwässerung mangelhaft. In anderen Gegenden dagegen habe das Risiko durch vorausschauende Städteplanung, Kanalsysteme und die Konstruktion von Rückhalteflächen minimiert werden können.
Hinter den Philippinen finden sich mit Indien und Indonesien zwei weitere Staaten aus Asien auf dem jährlich aktualisierten Ranking, das im Rahmen des Weltrisikoberichts herausgegeben wird. In der Gesamtschau weist allerdings Afrika die höchste Vulnerabilität auf. Darunter fassen Fachleute Faktoren wie soziale Ungleichheit oder schwache Gesundheitssysteme zusammen, die im Falle von Naturkatastrophen deren Folgen verschlimmern.
Die Zunahme an extremen Wetterereignissen überfordere bestehende Schutzsysteme und sorge für wachsende Schäden, heißt es in dem zusammen mit dem Weltrisikoindex herausgegebenen Weltrisikobericht. Für die Zeit zwischen 2020 und 2024 beziffern die Autoren der Studie allein die durch Überschwemmungen weltweit hervorgerufenen Schäden auf 325 Milliarden US-Dollar. „Die teuerste Flutkatastrophe ereignete sich im Juli 2021 in Mitteleuropa mit 59 Milliarden US-Dollar Schäden durch Sturzfluten im Ahrtal und angrenzenden Regionen.“
Angesichts des Klimawandels werden Überschwemmungen und Starkregen den im Weltrisikobericht zitierten Prognosen zufolge weltweit zunehmen. So stieg der Meeresspiegel aufgrund der Erderwärmung seit 1880 weltweit um 21 bis 24 Zentimeter. Davon könnten bis 2050 rund eine Milliarde Menschen betroffen sein. Schon jetzt lebten zudem 1,81 Milliarden Menschen in Gebieten, die einem erheblichen Überschwemmungsrisiko ausgesetzt seien.
Vor diesem Hintergrund rufen die Expertinnen und Experten zu mehr Klima- und Umweltschutz sowie zu angemessenen Investitionen in die Katastrophenvorsorge auf. Überdies warnen sie davor, Entwicklungshilfe-Etats weiter zu kürzen. Flutrisiken etwa seien kein Naturgesetz, betont die Geschäftsführerin vom Bündnis Entwicklung Hilft, Ilona Auer-Frege. „Sie sinken, wenn Vorsorge, soziale Gerechtigkeit und politischer Wille zusammenkommen - lokal umgesetzt, wissenschaftlich fundiert und mit intakten Ökosystemen.“
Weltrisikobericht 2025
Der Weltrisikobericht wird vom Bündnis Entwicklung Hilft herausgegeben, dem beispielsweise das katholische Hilfswerk Misereor angehört. Seit 2018 kooperiert das Bündnis Entwicklung Hilft dabei mit dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität Bochum.

Kritik an geplanter Umstrukturierung im Auswärtigen Amt

Außenminister Wadephul fordert mehr Geld für humanitäre Hilfe

Philippinen besonders betroffen: Weltrisikobericht blickt auf Katastrophengefahr
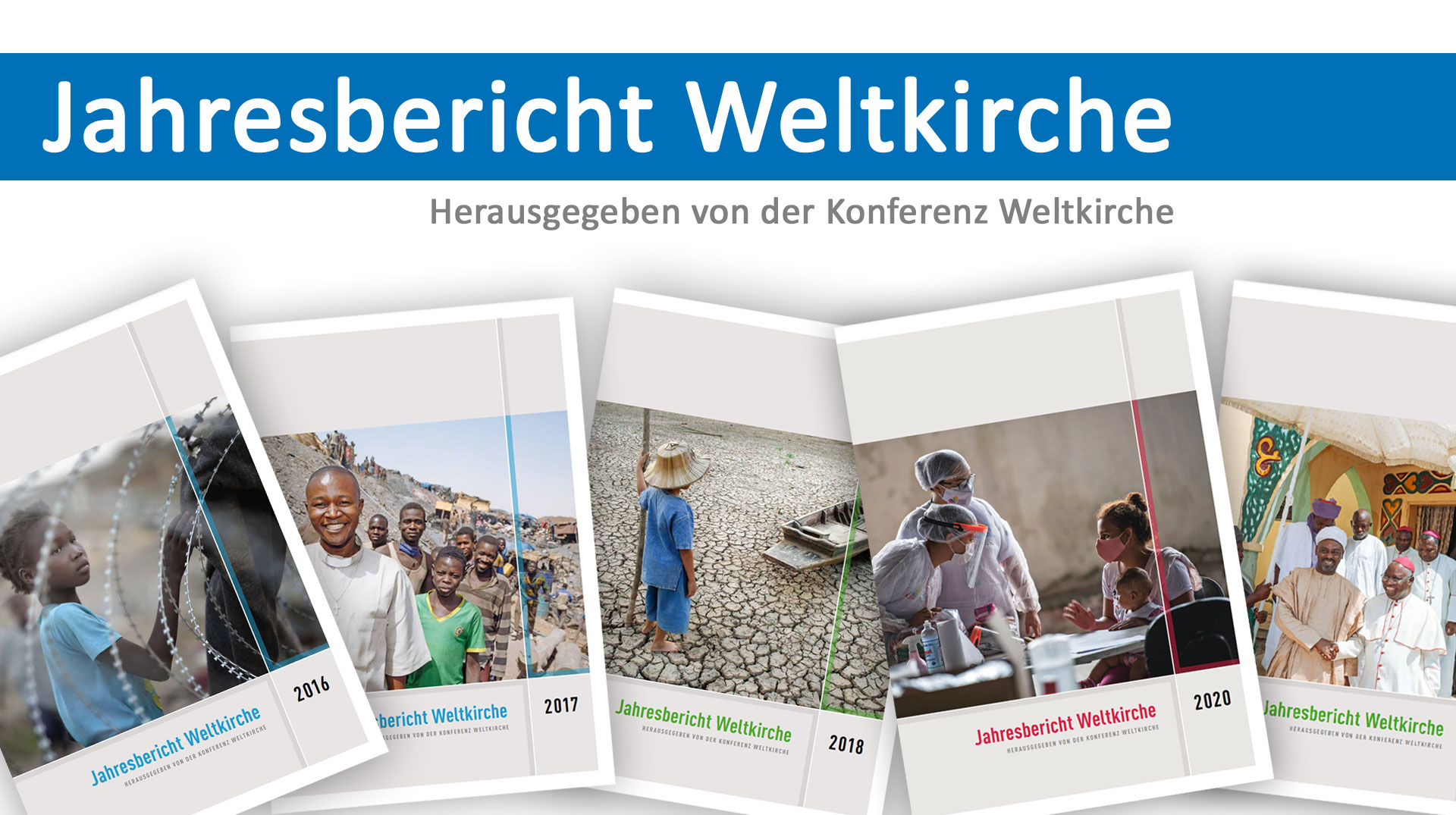
Jahresbericht Weltkirche

Humanitäre Hilfe im Ausland soll neu aufgestellt werden

Trauriger Rekord: Mehr humanitäre Helfer im Einsatz getötet

Experte: Europa muss humanitäre Hilfe besser koordinieren

Caritas international kritisiert Hilfsgüter-Abwurf über Gaza

