Völkermord – kaum ein juristischer Begriff polarisiert so sehr
Bonn ‐ Der Tatbestand „Genozid“ wurde geschaffen, um Massenverbrechen benennen und bestrafen zu können. Doch was dem Schutz der Menschen dienen sollte, wurde zum Problem des Völkerrechts.
Aktualisiert: 16.06.2025
Lesedauer:
Genozid – mit diesem Begriff wollte der polnisch-jüdische Jurist Raphael Lemkin (1900-1959) den Holocaust begreifbar machen und unter Strafe stellen. Heute ist kaum ein anderer juristischer Ausdruck derart emotional, politisch und moralisch aufgeladen.
Völkermord gilt als das Verbrechen aller Verbrechen, dennoch tun sich Juristen schwer mit dem Begriff. Dabei ist er, zumindest in der Theorie, klar definiert: Die vorsätzliche Zerstörung oder Ermordung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe wird als Genozid gekennzeichnet. So steht es in der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen vom Dezember 1948.
Denn wie weist man nach, dass ein Staat oder das Militär mit systematischem Vernichtungswillen gehandelt hat? Und warum fallen nicht auch politische, soziale oder kulturelle Gruppen unter diesen Schutz? Und wer darf überhaupt entscheiden, wann ein Massaker, eine Vertreibung oder eine Gewaltkampagne den Namen „Genozid“ verdient? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Juristen immer wieder.
Raphael Lemkin, ein polnisch-jüdischer Jurist, hat den Begriff Völkermord (Genozid) 1944 geprägt. Er hat sein Leben der Bekämpfung des Völkermords gewidmet, in dem er dafür gesorgt hat, dass der Genozid als ein Verbrechen nach internationalem Recht geahndet werden kann. Auf sein Betreiben geht auch die Konvention der Vereinigten Nationen gegen den Völkermord Im Jahr 1948 zurück.
Geboren wurde Raphael Lemkin am 24. Juni 1900 in Bezwodne, damals Teil des russischen Zarenreichs. Er studierte Jura in Lemberg (heute Lwiw in der Ukraine) und Warschau (heute Warszawa, Polen) und beschäftigte sich schon früh mit dem Thema, wie man Gewalt gegen Völker bestrafen kann. Zu jener Zeit konnten Staaten im Prinzip mit ihrer Bevölkerung machen, was sie wollten.
Was Lemkin prägte, waren nicht nur historische Berichte über Massaker wie das an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915, sondern auch die persönliche Erfahrung von Verfolgung. Als das NS-Regime mit dem Überfall auf Polen im September 1939 den Zweiten Weltkrieg begann, floh Lemkin erst nach Schweden, später in die USA. Aus seiner Familie wurden 49 Menschen im Holocaust ermordet, darunter seine Eltern.
Vorsatz schwer nachzuweisen
Der Jurist Lemkin wollte ein internationales Recht schaffen, das es bei gezielter Ermordung ethnischer oder religiöser Gruppen ermöglichte, die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Zu diesem Zweck führte er den Begriff des Genozids ein.
„Dieses neue Wort, das vom Autor geprägt wurde, um eine alte Praxis in ihrer modernen Entwicklung zu bezeichnen, setzt sich aus dem altgriechischen Wort genos (Ethnie, Stamm) und dem lateinischen cide (Töten) zusammen“, schrieb er in seinem 1944 veröffentlichten Buch „Axis Rule in Occupied Europe“ (Die Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa).
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kämpfte Lemkin unermüdlich dafür, dass seine Idee in das Völkerrecht einging. Er belagerte Diplomaten, schrieb unzählige Briefe, verfasste Eingaben, führte Gespräche auf den Fluren der Vereinten Nationen – mit Erfolg. 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes.
Doch mit dem Erfolg kamen die Schwierigkeiten. Der Text der Konvention ist bemerkenswert klar, aber auch eng gefasst. Nur vier Gruppen sind geschützt: nationale, ethnische, rassische und religiöse Gruppen.
Das zentrale juristische Problem des Genozid-Begriffs ist bis heute der Vorsatz. Um einen Völkermord nachzuweisen, genügt es nicht, dass Tausende oder Millionen Menschen getötet wurden. Es muss nachgewiesen werden, dass die Täter beabsichtigten, eine Gruppe „als solche“ zu zerstören. Das macht die juristische Beweisführung extrem schwierig. Der Jurist Philippe Sands sagte zu diesem Thema, nach seiner Erfahrung neigen die Beteiligten an solchen Morden nicht dazu, ihre Absicht offenzulegen oder Spuren in Gestalt von einschlägigen Unterlagen zu hinterlassen.
Außerdem verpflichtet die UN-Konvention die Mitgliedstaaten nicht nur zur Verurteilung des Völkermordes, sondern auch zu seiner Verhinderung. Wer Genozid benennt, muss also auch handeln. Damit wird es politisch richtig schwierig.
Raphael Lemkin wurde zehnmal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, bekommen hat er ihn nie. Er starb 1959 in New York, einsam und verarmt. Heute gilt er als Pionier des Völkerrechts, nach dem verschiedene Preise benannt sind.
Mehr zu Thema

Wie Nour der Kinderarbeit entkam

Renovabis mahnt: Wohlstand nicht auf Kosten von Menschen aus Osteuropa sichern

2024 wieder mehr Landminen-Opfer
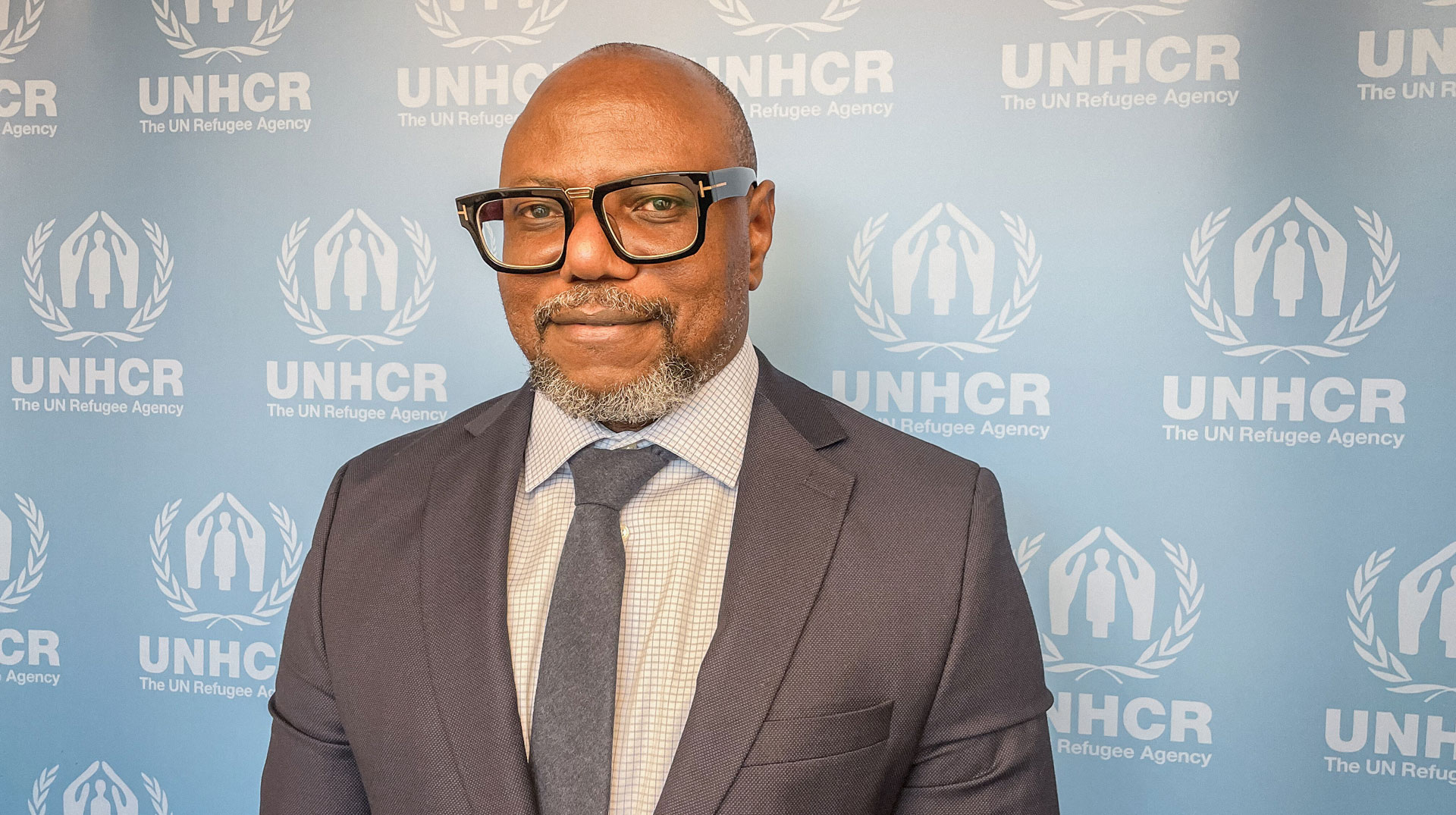
UNHCR-Vertreter im Sudan: Die Menschen rennen um ihr Leben

Friedensnobelpreis geht an María Corina Machado

Menschenrechtsbeauftragter Castellucci: Müssen in die Offensive

Russland verlässt Anti-Folter-Konvention

Venro: Preis für abgeschwächtes Lieferkettengesetz zahlen Menschen im Globalen Süden

