
Angola ist seit 50 Jahren unabhängig
Luanda/Bonn ‐ Endlich unabhängig von Portugal. Die Freude darüber dauerte in Angola allerdings nicht lange, folgte doch ein Jahrzehnte dauernder Bürgerkrieg. Auch danach machte es eine kleine, korrupte Elite nicht besser.
Aktualisiert: 10.11.2025
Lesedauer:
Der Countdown läuft: Auf der staatlichen Homepage zum großen Jubiläum zählt die Regierung Angolas die Tage bis zum 11. November runter. An diesem Tag im Jahr 1975 wurde das Land im Südwesten Afrikas von der einstigen Kolonialmacht Portugal unabhängig – als eines der letzten Länder des Kontinents überhaupt, hielt Portugal doch lange an seinen Kolonien fest; neben Angola waren das Guinea-Bissau und Mosambik.
Das Motto des Jubiläums lautet: „Angola 50 Jahre – Die erreichten Errungenschaften bewahren und wertschätzen, eine bessere Zukunft gestalten“. Das ganze Land soll in die Nationalfarben Schwarz, Rot und Gelb gehüllt werden und ordentlich feiern. Die nationale Unabhängigkeit stelle schließlich die größte Errungenschaft des angolanischen Volkes dar.
Nach Feiern dürfte vielen der 37 Millionen Einwohner allerdings nicht zumute sein, zu frisch sind die Erinnerungen an den Monat Juli. Bei Protesten starben 30 Menschen; laut UN-Angaben wurden mehr als 1.000 Personen festgenommen, zivilgesellschaftliche Organisationen sprechen von 1.500. Auslöser war zunächst der Anstieg der Benzinpreise - in Ländern ohne regelten Personennahverkehr und Alternativen sowie hohen Armutsraten können schon wenige Cent dramatische Auswirkungen haben.
Vor allem machten die Proteste zwei Entwicklungen deutlich: Angola ist zwar drittgrößter Ölproduzent Afrikas und verfügt laut Weltbank über fruchtbare Böden und ideales Klima, um Landwirtschaft im großen Stil zu betreiben. Doch verschiedenen Analysen zufolge gilt die Hälfte der Bevölkerung als arm; etwa jeder zweite Angolaner lebt von – statistisch gesehen – weniger als 3,65 US-Dollar pro Tag. Auf dem Entwicklungsindex der Vereinten Nationen belegt das Land Platz 148 von 193.
Angola gehört zu den größten Volkswirtschaften Afrikas, ist aber extrem abhängig vom Öl, das knapp zwei Drittel der Staatseinnahmen ausmacht. Genutzt wurden diese aber nicht, um etwa andere Wirtschaftszweige auszubauen. Stattdessen beansprucht eine kleine Elite in der Hauptstadt Luanda, dem absoluten Machtzentrum des Landes, die Gewinne für sich.
Deutlich machten die jüngsten Proteste auch die Unzufriedenheit mit der Regierung von João Lourenço, der seit 2017 Präsident ist und damit José Eduardo dos Santos nach 38 Jahren an der Macht ablöste. Lourenço steht jedoch nicht nur wegen der schwierigen Wirtschaftslage in der Kritik, sondern beispielsweise auch wegen Einschränkungen der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. So unterzeichnete er 2024 ein Gesetz, das Haftstrafen von bis zu 25 Jahren für Personen vorsieht, die an Protesten teilnahmen, welche zu Vandalismus und Störungen der öffentlichen Versorgung führten.
Enttäuschte Hoffnungen
Dabei setzte die Bevölkerung anfangs durchaus Hoffnung in Lourenço, die schwierigen Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit zu überwinden – möglich wurde diese überhaupt erst durch die Nelkenrevolution in Portugal im Jahr 1974 und dem Ende der dortigen Militärdiktatur.
Denn Angola erlebte Jahrzehnte lang Gewalt und Krieg. Schon in den 1950er Jahren formierten sich antikoloniale Gruppen. Mit der Unabhängigkeit kämpften verschiedene Befreiungsbewegungen um die Vorherrschaft. Ein Bürgerkrieg war die Folge. Gleichzeitig mischten in dem Stellvertreterkrieg in der Hochphase des Kalten Krieges zahlreiche Länder mit.
Das kommunistische Kuba unterstützte die Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA) mit Soldaten; Südafrikas Armee – und damit indirekt auch die USA – wiederum die Nationale Front zur Befreiung Angolas (FNLA) und die Vereinigung für die völlige Unabhängigkeit von Angola (UNITA). Erst 2002 wurde der Krieg beendet, nach mehreren erfolglosen Friedensmissionen.
Immer mit dabei ein Name: dos Santos, der nach dem Tod des ersten Präsidenten im Jahr 1979, António Agostinho Neto, dessen Nachfolge übernahm, ohne jedoch gewählt zu werden. Der MPLA-Mann hielt sich meist im Hintergrund, häufte aber vor allem nach Kriegsende ein enormes Vermögen an.
Seine Tochter Isabel war laut „Forbes-Magazin“ die erste afrikanische US-Dollar-Milliardärin. Die zahlreichen Deals machte im Jahr 2020 schließlich das „Internationale Konsortium investigativer Journalisten“ unter dem Titel „Luanda Leaks“ öffentlich. Ermittlungen wurden aufgenommen, Gelder eingefroren, ein Strafverfahren wegen Korruption und Untreue eingeleitet.
In einem Interview im Mai 2025 mit der Deutschen Welle nannte Isabel dos Santos all das allerdings „politisch motiviert“ und gab sich kämpferisch. Ob sie einmal das Familienbusiness fortsetzen wird? Im Interview schloss sie eine Kandidatur um das Präsidentenamt jedenfalls nicht aus.

Angola ist seit 50 Jahren unabhängig
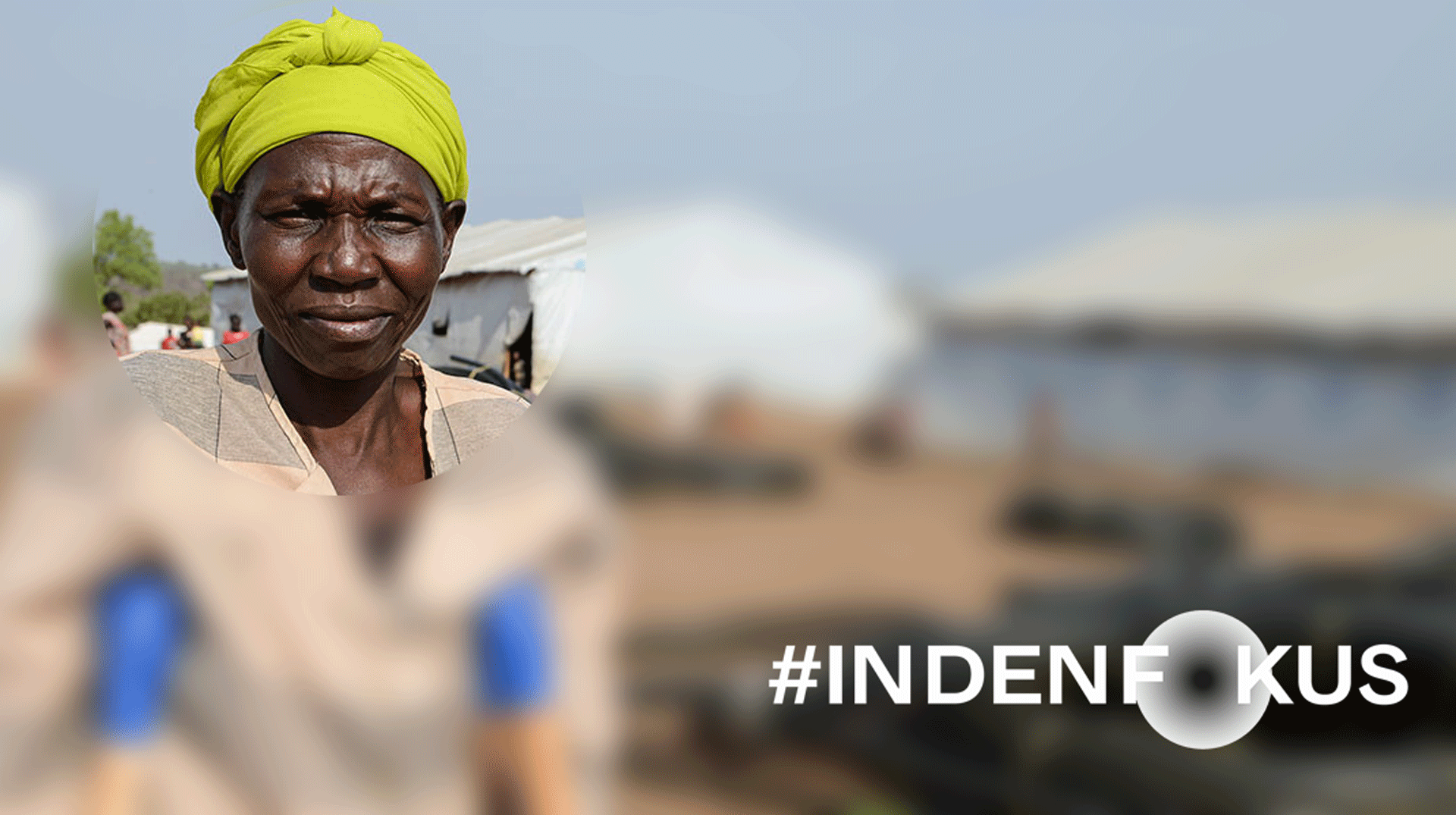
Angola führt Rangliste der zehn vergessenen Krisen 2024 an

Angola führt erneut Liste der vergessenen humanitären Krisen an

