Sicherheitslage im Niger nach Putsch weiter kritisch
Cotonou/Niamey ‐ Im Juli putschte im Niger die Armee – angeblich, um die grassierende Gewalt im Land einzudämmen. Doch verbessert hat sich bisher nichts. Menschen verlassen weiter ihre Dörfer aus Angst vor islamistischen Terrorkommandos.
Aktualisiert: 04.10.2023
Lesedauer:
Drei Tage herrscht Staatstrauer im Niger. Sie soll 29 Soldaten ehren, die vergangene Woche bei einer Militäroperation in der Region Tillaberi im Südwesten des Landes ums Leben gekommen sind. Terroristen hätten sie mit selbstgebauten Sprengsätzen angegriffen, teilte das Verteidigungsministerium mit. An dessen Spitze steht seit dem Staatsstreich Ende Juli General Salifou Mody.
Nach Informationen der britischen BBC und von Radio France Internationale könnte die Opferzahl des jüngsten Angriffs jedoch bei mehr als 60 liegen. Sie berufen sich auf Augenzeugenberichte. Erst wenige Tage zuvor waren bei einem anderen Einsatz zwölf weitere Armeeangehörige ums Leben gekommen.
Terrorgruppen sind im Land aktiv
In der Region Tillaberi, auch als „Zone der drei Grenzen“ bekannt, ist vor allem der „Islamische Staat in der Größeren Sahara“ aktiv. Sie grenzt an Mali und Burkina Faso und gilt seit Jahren als Rückzugsort für bewaffnete Gruppierungen. Der Staat ist längst abwesend. Oft ist die Arbeit für Hilfsorganisationen kaum noch möglich.
Das hört auch Sadou Abdou immer wieder aus seinem Heimatland. Der Nigrer lebt seit 40 Jahren in Benins Wirtschaftsmetropole Cotonou. „Vor allem aus der Region Tillaberi kommen schlechte Nachrichten“, sagt er. Aus Angst vor Überfällen durch bewaffnete Gruppen schliefen viele Menschen nicht mehr in ihren Dörfern. Damit sie keine Hilfe holen können, hätten die Terroristen zudem Mobilfunkmasten zerstört. Informationen über Angriffe sind deshalb mitunter einige Tage alt, bevor sie die Hauptstadt Niamey erreichen.

Niamey, Hauptstadt des Niger
„Wir wollen in Frieden leben und sind die Gewalt leid. Über Niger heißt es immer, dass es das ärmste Land der Welt ist. Dabei könnten wir mit unseren Bodenschätzen wie Uran und Gold ein aufstrebender Staat sein.“ Abdou setzt deshalb auf die Junta von Abdourahamane Tiani, die Ende Juli Präsident Mohamed Bazoum stürzte. Mittlerweile heißt es, dass Niger einer Vermittlung durch Algerien zugestimmt habe. Frühere Vermittlungsversuche, beispielsweise von Seiten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas, die gleichzeitig mit einer Militär-Intervention drohte, sind gescheitert.
Das Militär hatte die Absetzung Bazoums unter anderem mit der schlechten Sicherheitslage im Land begründet. Nach Informationen von ACLED, die nichtstaatliche Organisation sammelt Daten zu Konflikten weltweit, sind seit dem Staatsstreich indes mehr als 240 Menschen ums Leben gekommen. Damit stiegen die Zahlen im Vergleich zu den Monaten davor.
Sadou Abdou hofft unterdessen auch auf das Ende eines neokolonialen Systems. Er kritisiert: „Länder wie Frankreich wollen unsere Rohstoffe. Doch wir wollen Fabriken, um sie selbst zu verarbeiten.“ Der Einfluss der einstigen Kolonialmacht Frankreich – Präsident Emmanuel Macron kündigte Ende September den Abzug der 1.500 im Niger stationierten Soldaten an – wird im Sahel zunehmend scharf kritisiert. General Tiani betonte in einem Fernsehinterview, dass Niger künftig selbst über seine Beziehungen zu Frankreich entscheide.
Abseits von politischen Debatten sind im Niger Millionen von Menschen mit dem Überleben beschäftigt. Durch die geschlossenen Grenzen als Sanktionsmaßnahme kommen beispielsweise Güter aus dem Hafen von Cotonou nicht ins Land. Lkw-Fahrer sitzen in der beninischen Grenzstadt Malanville fest. Der Grenzfluss lässt sich nur mit Booten überqueren. In Niamey sagt der katholische Missionar Mauro Armanino: „Die Menschen haben sich an die Unsicherheit und Ungewissheit gewöhnt.“ Sie müssten versuchen, trotz gestiegener Lebensmittelpreise ihre Kinder zu versorgen und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Selbst in der Krise gibt es einen Alltag.
Von Katrin Gänsler (KNA)
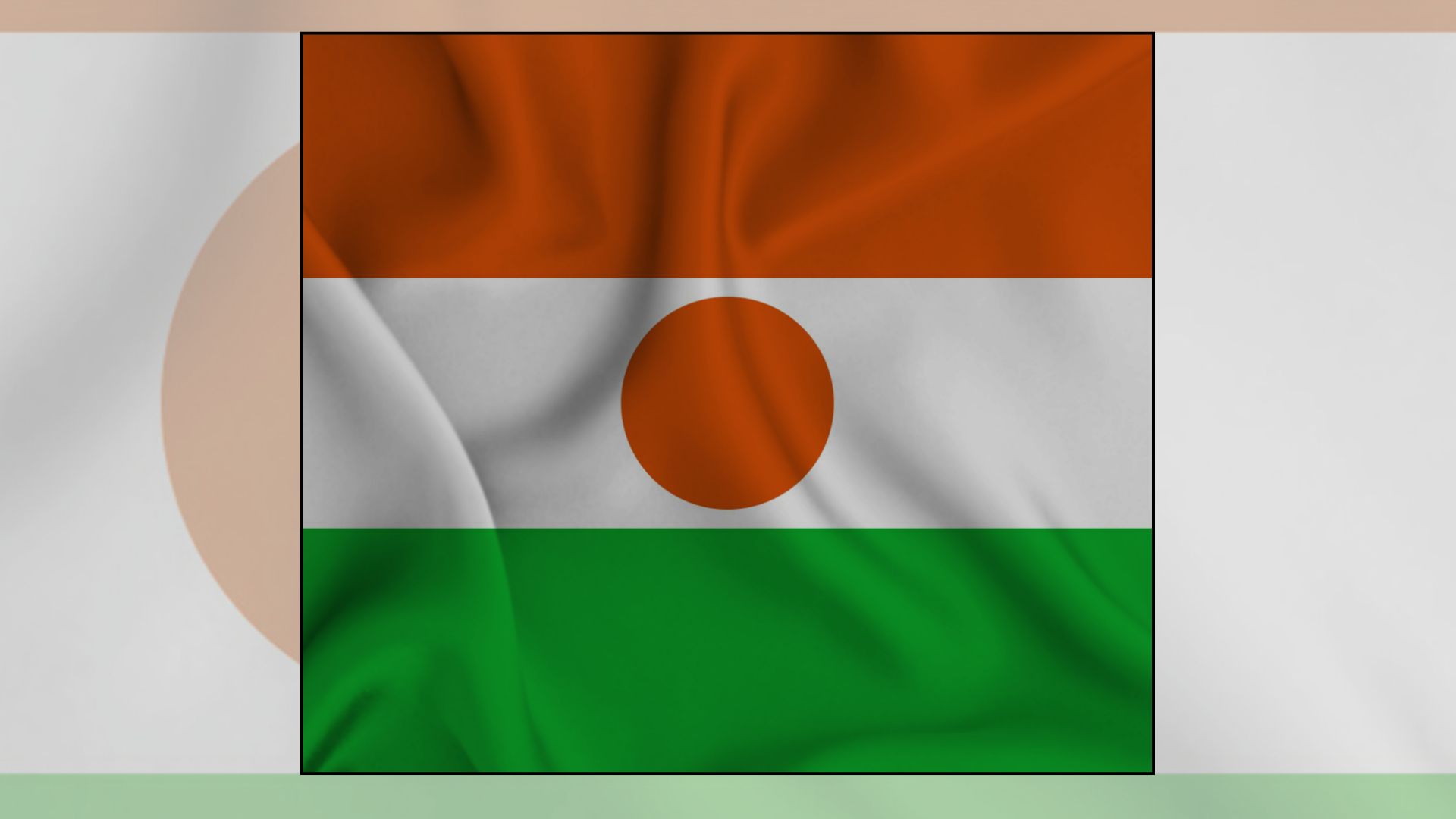
Christen in Niger immer stärker unter Druck

Europas schwierige Partnerschaft mit dem Sahel

