
Von einer Westkirche zur Weltkirche
Katakombenpakt ‐ Er war ein Nebenschauplatz des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und doch entfaltete er in der Weltkirche eine ungeahnte prophetische Wirkung: der „Katakombenpakt“. Vor 50 Jahren von rund 40 Bischöfen unterzeichnet hat der Pakt für eine dienende und arme Kirche heute nichts an Aktualität verloren, wie der Konzilsexperte Pfarrer Norbert Arntz weiß.
Aktualisiert: 21.07.2022
Lesedauer:
Gegen Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, am 16. November 1965, versammelten sich 40 Konzils-Bischöfe in den Domitilla-Katakomben in Rom, um einen Pakt für eine dienende und arme Kirche zu unterzeichnen. Warum der Katakombenpakt auch fünfzig Jahre später nichts an Aktualität verloren hat, erklärt Pfarrer Norbert Arntz, Mitarbeiter des Instituts für Theologie und Politik in Münster, im Interview.
Frage: Herr Arntz, fast 50 Jahre ist es her, dass 40 Bischöfe am Rande des Zweiten Vatikanischen Konzils zusammenkamen und einen Pakt für eine dienende und arme Kirche schlossen. Was war der Anlass dieses Katakombenpaktes?
Arntz: Bischöfe aus 18 Nationen fanden sich gleich zu Beginn des Konzils zur Gruppe „Kirche der Armen“ zusammen. Sie wollten die Armen in den Mittelpunkt des Konzils rücken. Alle von weltlichen Herrschaftstraditionen übernommenen Formen müssten in der Kirche beseitigt werden. Es müsse Schluss sein mit dem zeitweiligen Bündnis zwischen der Kirche und dem „Imperialismus des Geldes“. Sie wollten das Konzil dazu bewegen, „zur Seele dieses Konzils das Geheimnis Christi in den Armen zu machen“, sagte Kardinal Lercaro, der damalige Erzbischof von Bologna, am 6. Dezember 1962. Kurzum: Was man „konstantinische Ära“ zu nennen pflegt, sollte mit dem Konzil ein Ende haben.
Frage: Im Vorwort Ihres kürzlich erschienen Buches sprechen Sie vom Katakombenpakt als „geheimes Vermächtnis des Zweiten Vatikanischen Konzils“. Was ist darunter zu verstehen?
Arntz: Beim Katakombenpakt handelt sich ja nicht um ein offizielles Konzilsdokument, das in den Domitilla-Katakomben unterzeichnet wird. Allerdings ist es am Rande des Konzils im Laufe der dreijährigen Beratungen entstanden, vor allem in der Gruppe „Kirche der Armen“. Dass man es in den Katakomben unterzeichnete, lässt darauf schließen, kein öffentliches Aufsehen erregen zu wollen. Vielmehr wollte man sich still und verschwiegen gegenseitig in der Umkehr „zu einer dienenden und armen Kirche“ bestärken. Diese Umkehr muss eben „von innen kommen“. Die Wahl des Ortes scheint aber auch von der Deutung mit beeinflusst worden sein, die Papst Paul VI. der Domitilla-Katakombe gab, als er am Vorabend der 4. Sitzungsperiode des Konzils, am 12. September 1965, dort eine heilige Messe feierte und dabei mit folgenden Worten an die Anfänge der Kirche erinnerte: „Für uns sind [die Katakomben] das Andenken an eine lange Geschichte der Verheimlichung, der Unpopularität, der Verfolgung und des Martyriums, der in Rom und in vielen Teilen seines Reiches in den ersten Jahrhunderten des Christentums die Kirche ausgesetzt war.“
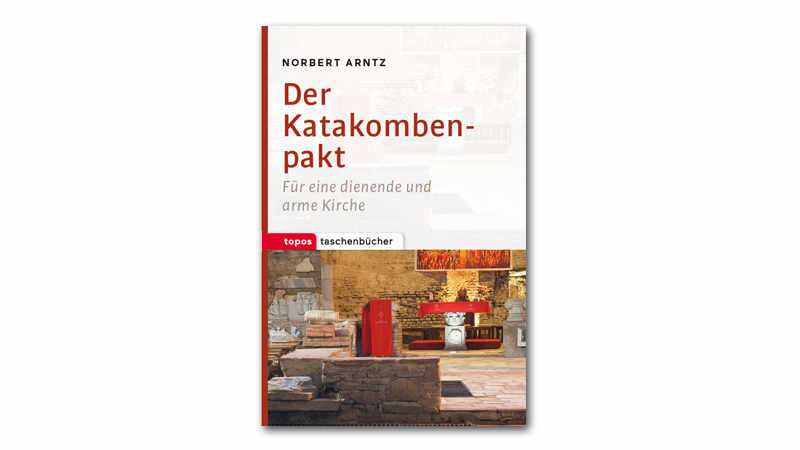
Dass man sich darüber hinaus dazu entschied, den Text des Katakombenpaktes am Vorabend des Konzilsendes an alle zu verteilen, gab den Willen zu erkennen, das Anliegen weiterhin aktiv zu vertreten, aber zugleich die Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen Konzilsvaters zu respektieren. Der Text wurde nicht verteilt, weil man die anderen Konzilsbischöfe um ihre Unterschrift oder eine andere Geste demonstrativer Unterstützung bitten wollte. Der Text sollte mehr im Sinne einer Meditationsvorlage und eines Gewissensspiegels Verwendung finden. Später schlossen sich dem Pakt tatsächlich fünfhundert weitere Bischöfe an.
Frage: Trotz des Engagements der Gruppe „Kirche der Armen“ spielte das Thema „Armut“ bei der Mehrheit der Konzilsväter keine herausragende Rolle. Warum?
Arntz: Die Bischöfe aus Mitteleuropa und Nordamerika hielten andere Themen für wichtiger, Aufarbeitung der Aufklärung zum Beispiel oder Anerkennung der Menschenrechte und der Gewissens- bzw. Religionsfreiheit. Das alles gehörte zweifellos zum Nachholbedarf der „Kirche in der Welt von heute“. Aber die Mehrheit der Bischöfe hatte offenkundig kein Verständnis dafür, dass eben diese Aufarbeitung aus der Perspektive der Armen geschehen musste. Die Mehrheit der Bischöfe war bürgerlich und kannte das Problem der Klassenunterschiede nicht.
„Durch die gemeinsam getroffenen Selbstverpflichtungen erzielte die Gruppe „Kirche der Armen“ eine tief reichende spirituelle und prophetische Wirkung für die Weltkirche.“
Frage: Unter Papst Franziskus haben die Ideen des Katakombenpakts wieder Aufwind erfahren. Was ist heute, ein halbes Jahrhundert später, aus dem Versprechen für eine dienende und arme Kirche geworden?
Arntz: Selbst wenn der Gruppe „Kirche der Armen“ die institutionelle Wirkung auf das Konzil selbst versagt blieb, durch die gemeinsam getroffenen Selbstverpflichtungen erzielte die Gruppe eine tief reichende spirituelle und prophetische Wirkung für die Weltkirche. Die Unterzeichner des Katakombenpaktes haben einerseits persönlich durch Tat und Wahrheit – auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens – bewiesen, dass eine vom konstantinischen Modell befreite Kirche möglich ist. Sie haben andererseits dafür Sorge getragen, dass die Wirkung des Paktes auch ihr persönliches Engagement übersteigt.

In keiner anderen kirchlichen Region geschah das so spürbar wie in Lateinamerika. Keine andere Kontinentalkirche organisierte den Prozess konziliarer Erneuerung so entschieden wie die vom Lateinamerikanischen Bischofsrat CELAM zusammengeführte Kirche. Keine andere Kontinentalkirche war deshalb auch in solch heftige weltpolitische und gesamtkirchliche Konflikte verstrickt wie die lateinamerikanische. Sie erlitt wieder, was Paul VI. für die Katakomben-Kirche erinnert hatte: „Verheimlichung, Unpopularität, Verfolgung und Martyrium“. Die Konflikte zeigten die Geburtsschmerzen einer neuen Phase in der Geschichte der Kirche an: Sie wird erst, was sie im Konzil behauptet zu sein – „Weltkirche“. Aber der Übergang von der Westkirche zur Weltkirche ist immer noch nicht vollzogen. Dieser Prozess durchläuft stets neue Konfliktphasen. Das lässt sich exemplarisch an der lateinamerikanischen Kirche ablesen. Das erweist sich erneut im derzeitigen Pontifikat von Papst Franziskus. Dieser Papst ist ohne die Wirkungen des Katakombenpaktes in der Geschichte der lateinamerikanischen Kirche nicht zu verstehen.
Frage: Anlässlich des 50. Jahrestags des Katakombenpaktes wird in Rom ein internationales Treffen mit Gottesdiensten, Workshops und Vorträgen rund um das Thema Kirche der Armen veranstaltet. Was erwartet die Teilnehmenden dort konkret?
Arntz: Die Veranstaltung wird von einem großen Kreis verschiedener Gruppen und Institutionen getragen – darunter auch das Institut für Theologie und Politik. Wir wollen mit Vertretern christlicher Basisbewegungen in Lateinamerika und Afrika Zeichen setzen, dass der Katakombenpakt kein historisches Relikt ist, sondern dass seine Anliegen weltweit im konkreten Engagement an der Seite der Armgemachten und Marginalisierten gelebt werden. So wollen wir den Katakombenpakt erinnern und erneuern.
Frage: Welche Impulse für die Erinnerungsarbeit zum Katakombenpakt soll diese Veranstaltung geben?
Arntz: Wir lassen uns von Bischof Bettazzi, dem einzigen lebenden Erstunterzeichner in Europa, erzählen, was damals in ihm vorging. Bischof Erwin Kräutler aus dem Amazonasgebiet Brasiliens ist Zeuge dafür, wie die ökonomischen Interessen multinationaler Unternehmen die Umwelt zerstören und die Menschenwürde der dortigen Bevölkerung bedrohen; zugleich wird er davon erzählen, wie die Kirche mit und in den traditionellen Völkern der Region Widerstand leistet. Der Theologe Jon Sobrino aus El Salvador, einst ein enger Mitarbeiter des Erzbischofs Romero, wird uns an den Leitgedanken des ermordeten und inzwischen seliggesprochenen Bischofs erinnern: „Gott wird dort angebetet und geehrt, wo und wenn die Armen leben können.“
Das Interview führte Lena Kretschmann.
© weltkirche.katholisch.de
