
Gewaltiges Brasilien
Heute beginnt in Weimar der Runde Tisch Brasilien , die größte Brasilienfachtagung im deutschsprachigen Raum. Die Themen: Medien, Proteste und Gewalt. Dies dürfte kein Zufall sein. Schließlich kam es in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land zu den größten Massenprotesten seit dem Ende der Militärdiktatur in den 1980er Jahren. Der Franziskanerpater Frei Luciano Bruxel nimmt als Referent an der Fachtagung teil. Im Interview mit dem Internetportal Weltkirche spricht er über Brasiliens Jugend und die Rolle der Medien bei den Demonstrationen.
Aktualisiert: 12.07.2015
Lesedauer:
Heute beginnt in Weimar der Runde Tisch Brasilien , die größte Brasilienfachtagung im deutschsprachigen Raum. Die Themen: Medien, Proteste und Gewalt. Dies dürfte kein Zufall sein. Schließlich kam es in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land zu den größten Massenprotesten seit dem Ende der Militärdiktatur in den 1980er Jahren. Der Franziskanerpater Frei Luciano Bruxel nimmt als Referent an der Fachtagung teil. Im Interview mit dem Internetportal Weltkirche spricht er über Brasiliens Jugend und die Rolle der Medien bei den Demonstrationen.
Frage: Im Juni dieses Jahres gingen in Brasilien hunderttausende Jugendliche auf die Straße, um gegen die Fußball-WM, Korruption und soziale Missstände zu demonstrieren. Was hat sich seitdem getan?
Pater Frei Luciano Bruxel: Die Dimension der Demonstrationen hat viele Leute überrascht. Der Auslöser war die Erhöhung der Preise für öffentliche Verkehrsmittel, doch eigentlich wurde gegen eine ganze Bandbreite von Themen demonstriert – unter anderem auch gegen die großen sozialen Unterschiede in der brasilianischen Gesellschaft. Die Größe der Proteste spiegelte sich jedoch nicht nur in der Vielfalt der Themen wieder, sondern auch in der Stoßrichtung der Kritik: Der Unmut der Jugendlichen richtete sich quer durch die Parteienlandschaft gegen alle politischen Instanzen – und das mit positivem Ergebnis: Die Proteste haben sowohl bei der Regierung als auch bei den einzelnen Parteien einen Reflexionsprozess in Gang gesetzt.
Frage: Wie äußerte sich dieser?
Luciano: Ganz konkret zeigt sich das zum Beispiel in Rio Grande do Sul, im Süden von Brasilien. Dort konnte erreicht werden, dass der öffentliche Nahverkehr für Studenten kostenlos wird. Darüber hinaus bewegte sich auch etwas im Gesundheitsbereich. Die Regierung hat Kooperationen mit anderen Ländern angestoßen, so dass nun zum Beispiel Ärzte aus Kuba zum Arbeiten nach Brasilien kommen. Sie unterstützen die einheimischen Mediziner vor allem in den ländlichen Gebieten, in denen es oft zu wenig Ärzte gibt.
Frage: Welche Rolle spielten soziale Medien, wie Facebook und Twitter, bei der Organisation der Proteste?
Luciano: Sie haben die Demonstrationen als breite Bewegung erst ermöglicht. Es war eine überraschende Erkenntnis, dass die sozialen Medien in ihrer Reichweite mächtiger sein können als die politischen Kommunikationsorgane und klassische Massenmedien, wie Zeitungen, Fernsehen oder Radio. In einem riesigen Staat wie Brasilien war es bisher unmöglich, das ganze Land einheitlich zu mobilisieren. Das ist jetzt passiert. Die Bewegung „Aufstand der Jugend“ hat es beispielsweise mittels Facebook und Twitter geschafft, die Jugendlichen in ganz Brasilien mit den gleichen Bannern und Plakaten auf die Straße zu bringen. Das ist eine ganz neue Entwicklung, die es vorher so nicht gab.
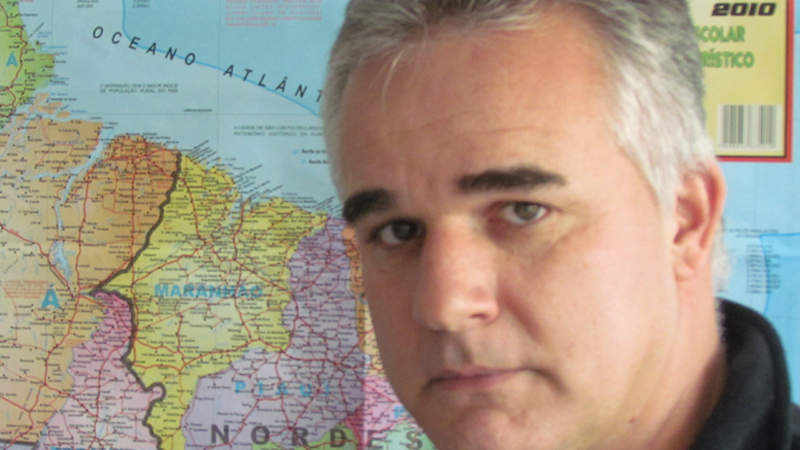
Man muss allerdings auch sehen, dass die ärmeren Bevölkerungsschichten die neuen Medien sehr viel weniger nutzen als die jungen Leute der Mittelschicht. Als Franziskaner sind wir sehr stark in den Armenvierteln der Städte und auf dem Land aktiv. Internet gibt es dort in der Regel nur in den Gemeindezentren oder in öffentlichen Einrichtungen. Daher verwenden die Jugendlichen die sozialen Medien vor allem um Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen, aber nicht um politische Kundgebungen zu organisieren.
Frage: Auf der Brasilienfachtagung in Weimar halten Sie ein Diskussionsforum zum Thema „Jugend und Medien: Balance-Akt zwischen Teilhabe und Ausschluss“. Was steckt hinter diesem Titel?
Luciano: Brasilien wird häufig als ein Land dargestellt, das sich sehr stark entwickelt und viele Fortschritte macht. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die Kehrseite ist, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich und die Gewalt, vor allem bei Jugendlichen, zunehmen. In Brasilien landen im Jahr 2010 ungefähr 64.000 Minderjährige im Gefängnis. Bei der Rolle der Medien dabei sind zwei Dinge festzustellen: Zum einen gaukeln die klassischen Massenmedien den Jugendlichen Konsumbilder vor und verführen sie somit zum Kauf bestimmter Produkte. Wenn aber das Geld nicht reicht, führt dies zu Diebstahl und Gewalt. Zum anderen werden die Jugendlichen in Zeitungen, Radio, Fernsehen und Co. häufig als Gewalttäter stigmatisiert. Das hängt unter anderem mit dem Bestreben der Medien zusammen, das Alter der Straffälligkeit von 18 auf 14 Jahre herunterzusetzen. Menschenrechtsorganisationen und die Kirche sind streng dagegen. Stattdessen versuchen wir, ein Ausbildungssystem auf den Weg zu bringen, das sich an gewalttätige Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren richtet. Sie müssen rechtzeitig aufgefangen und pädagogisch betreut werden.
Frage: Welche Folgen hat diese Stigmatisierung durch die Medien für die Jugendlichen?
Luciano: Die Massenmedien treten häufig als Bewahrer der Kultur und der Werte des Landes auf. Sie vermitteln den gewalttätigen Jugendlichen den Eindruck, dass sie nichts wert und für die Gesellschaft unsichtbar sind. Die jungen Menschen versuchen daraufhin, der Gesellschaft das Gegenteil zu beweisen. Das Problem dabei: Für sie ist Gewalt häufig der einzige Weg, sich öffentlich Gehör zu verschaffen – ein Teufelskreis.
Frage: Wie helfen Sie den Jugendlichen dabei, aus dieser Gewaltspirale herauszukommen?
Luciano: Den Jugendlichen müssen Räume angeboten werden, in denen sie wahrgenommen und als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden. Wir schaffen diese Räume, indem wir verschiedene Workshops, Seminare, Musik- und Kunstveranstaltungen anbieten. Dort können die Jugendlichen sich positiv erfahren und Selbstbewusstsein entwickeln.
Das Interview führte Lena Kretschmann.
