
Mut zur Armut
Kirche der Armen ‐ Vor 50 Jahren, am Rande des Zweiten Vatikanischen Konzils , schlossen 40 Bischöfe in den Domitilla-Katakomben von Rom einen Pakt, der ihr Leben und ihren kirchlichen Dienst von Grund auf ändern sollte: der Katakombenpakt der dienenden und armen Kirche. Im Gespräch mit dem Internetportal Weltkirche verrät der Theologe und Lateinamerika-Experte Willi Knecht, in welchen Regionen der Weltkirche der Geist des Konzils und die Verpflichtungen zu einer Kirche der Armen eine ungeahnte Dynamik entfaltete.
Aktualisiert: 12.07.2015
Lesedauer:
Vor 50 Jahren, am Rande des Zweiten Vatikanischen Konzils , schlossen 40 Bischöfe in den Domitilla-Katakomben von Rom einen Pakt, der ihr Leben und ihren kirchlichen Dienst von Grund auf ändern sollte: der Katakombenpakt der dienenden und armen Kirche. Im Gespräch mit dem Internetportal Weltkirche verrät der Theologe und Lateinamerika-Experte Willi Knecht, in welchen Regionen der Weltkirche der Geist des Konzils und die Verpflichtungen zu einer Kirche der Armen eine ungeahnte Dynamik entfaltete.
Frage: Bis Ende dieses Jahres feiert die katholische Kirche das 50-jährige Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965). Wo ist der „Geist des Konzils“ in der Weltkirche heute noch konkret zu spüren?
Knecht: Überall dort, wo es noch Elend und Ungerechtigkeit gibt. Die Option für die Armen, wie sie während des Konzils angedeutet wurde, meint nicht nur, auf der Seite der Armen zu stehen, sondern auch Demokratisierung: mehr Verantwortung für die Laien. Vor allem in den ärmeren Gegenden der Welt spielt dieser Gedanke eine große Rolle. Die kirchliche Evangelisierung und die soziale und pastorale Arbeit wären dort ohne die Mitarbeit vieler verantwortlicher Laien gar nicht möglich. Dieser Aspekt ist durch unseren Papst aus Lateinamerika wieder neu ins Bewusstsein gerückt.
Frage: Sie haben mehrere Jahre als Pastoralreferent in der peruanischen Diözese Cajamarca gearbeitet. Wie wurde dort das Anliegen des Konzils konkret umgesetzt?
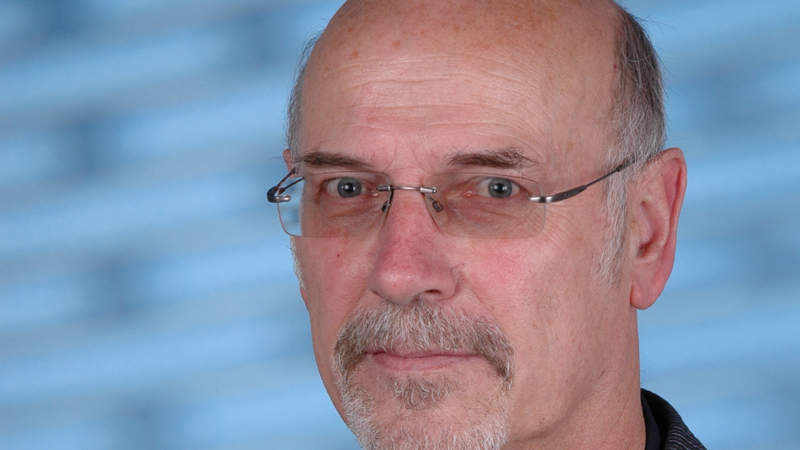
Knecht: Cajamarca gilt als eine der Diözesen, wo der Geist des Konzils am stärksten verwirklicht wurde. Den Anstoß dafür gab der damalige Bischof von Cajamarca, José Dammert. Er war der entscheidende Motor für die Bewegung der sogenannten „Kleinen Bischöfe“, die aus dem Katakombenpakt hervorgegangen ist. Anstatt sich auf die Seite der Großgrundbesitzer in Peru zu stellen, ging Bischof Dammert auf das Land zur indigenen Bevölkerung und verkündete dort das Evangelium. Die meisten Menschen hatten bis dahin noch nie etwas von Jesus gehört. Zusammen mit den Campesinos, den Landarbeitern, fand er neue Strukturen und Verantwortlichkeiten, zum Beispiel durften indigene Katecheten Männer und Frauen taufen, sie durften predigen und Gemeinden leiten. Das hat zu einem unglaublichen Aufbruch der Kirche geführt – und gleichzeitig zu einem Zurückdrängen von Gewalt und Ungerechtigkeit. Es gibt viele Zeugnisse von Campesinos, die sagen, durch das Konzil und Bischof Dammert hätten sie zum ersten Mal erfahren, was es hieße, Kind Gottes zu sein, ausgestattet mit einer unendlichen und unantastbaren Würde.
Frage: Die Forderungen des Katakombenpakts von 1965 nach einer dienenden und armen Kirche sind heute noch genauso aktuell wie damals. Wo sehen sie diese Verpflichtungen in der Kirche in Deutschland umgesetzt?
Knecht: Da sehe ich leider noch große Unterschiede. Die Kirche in Deutschland steckt in einem Dilemma. Auf der einen Seite ist sie die reichste Kirche der Welt. Sie hat die finanziellen Mittel, unglaublich viel Gutes zu tun – nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Das ist ein großer Schatz. Auf der anderen Seite bringt der Reichtum auch Gefahren mit sich. Er hat dazu geführt, dass die Hinwendung zu den Armen, wie sie die Kirche in Lateinamerika im Nachklang des Konzils vollzog, in Deutschland nie stattgefunden hat. Auf der zweiten Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Medellín wurde der Geist des Konzils konkret auf die Lebenswirklichkeit der Leute angewandt. Die Bischöfe kamen zu dem Schluss: So wie die Menschen in Lateinamerika leben, als Arme, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Gott will nicht, dass Kinder verhungern, obwohl es genügend Nahrungsmittel gibt. Diese theologische und gesellschaftspolitische Analyse wurde so in Europa und speziell in Deutschland nicht durchgeführt. Wäre dem so gewesen, hätte man sich vielleicht als eine Kirche entdeckt, die selbst in ein ausbeuterisches System eingebunden ist und von den herrschenden Verhältnissen mit profitiert. Das wäre eine sehr bittere Selbsterkenntnis gewesen. Aber gerade diese Einsicht ist notwendig.
„So wie die Menschen in Lateinamerika leben, als Arme, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit.“
Frage: Sehen sie die Kirche in Deutschland inzwischen auf einem guten Weg hin zu dieser Einsicht?
Knecht: Aktuell sehe ich viele positive Entwicklungen, die darauf hinweisen, zum Beispiel beim Umgang mit Flüchtlingen. Mit ihren zahlreichen Initiativen hat die Kirche hier beispielhaft Zeichen gesetzt – auch in meiner Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dort wird zum Beispiel das ehemalige Gästehaus des Klosters Weingarten in Oberschwaben als Flüchtlingsunterkunft genutzt. In vielen anderen Bistümern passiert ähnliches. In der Bevölkerung und speziell in den Kirchengemeinden herrscht eine hohe Bereitschaft zu helfen – nicht nur materiell, sondern auch durch die persönliche Begleitung von Flüchtlingen.

Frage: Auch Papst Franziskus liegt das Flüchtlingsthema sehr am Herzen. Ist er – vielleicht auch durch seine lateinamerikanische Herkunft – ein Hoffnungsträger für eine Kirche der Armen?
Knecht: In Argentinien, Peru und anderen lateinamerikanischen Ländern ist mit der Wahl von Franziskus eine sehr große Hoffnung für die Kirche der Armen entstanden. Die Menschen freuen sich, dass der Papst die Nöte und Ängste der Armen offen und laut in die Weltöffentlichkeit einbringt. Hier ist ein großer Aufschwung zu spüren. Diese Aufbruchsstimmung würde ich mir auch für die Kirche in Deutschland wünschen. Unsere Bischöfe müssen mutiger werden. Sie müssen es wagen, mehr Verantwortung in ihre Diözese hineinzutragen und nicht immer zuerst nach Rom zu schielen. Ich würde mir wünschen, dass die Bischöfe von dieser Freiheit viel mehr Gebrauch machen – auch was Strukturfragen anbelangt. Sie hätten dabei den Papst auf ihrer Seite.
„Unsere Bischöfe müssen mutiger werden. (...) Sie hätten dabei den Papst auf ihrer Seite.“
Frage: Mehr Freiheit ist ein Aspekt, den Papst Franziskus mitgebracht hat. Welche Veränderungen wird er gerade mit Blick auf eine Kirche der Armen noch in Gang setzen?
Knecht: Zum einen wird er die prophetische Aufgabe des Priester- und Bischofsamtes stärken. In Lateinamerika spricht man hier von Anklage und Verkündigung. Viele bestehende ungerechte Verhältnisse müssen als unvereinbar mit dem Evangelium angeklagt werden. Zugleich muss die Kirche eine Welt verkünden, in der alle Menschen das Notwendigste zum Leben haben und in Würde leben können. Eine Kirche, die ihr Vertrauen – de facto – vorrangig in ihren Besitz und irdische Güter und Werte setzt, kann nicht die Kirche Jesu Christi sein. Sie wird dann immer mehr zur Kirche Jesu Christi, wenn sie das tägliche Brot und alles, was der Mensch zum Leben braucht, mit denen teilt, denen man dies vorenthält oder gar geraubt hat.
Zum anderen werden sich unter Franziskus die Strukturen ändern. Der Papst hat schon zu Beginn seines Pontifikats gesagt, die Kirche drehe sich viel zu sehr um sich selbst. Die Ämter und Strukturen der Kirche sollen dem Menschen dienen und nicht sich selbst. Hier werden wir noch einige Überraschungen erleben.
Das Interview führte Lena Kretschmann.
